13. Februar 2014
Schauplatz „Tatort“
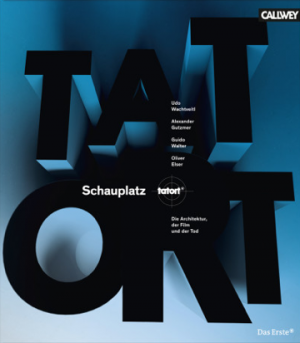 Gestrige Tages-meldung: Meret Becker bildet zusammen mit Mark Waschke das neue Er-mittlerpaar im rbb-„Tatort“. Das gefällt mir gut, weil ich Meret seit ihrer Schulzeit kenne und als Schau-spielerin besonders schätze. – Im Münchner Callwey-Verlag ist kürzlich ein großes und sehr schönes Buch über die „Tatort“-Reihe erschienen. Sein Untertitel: „Die Architektur, der Film und der Tod“. Zunächst werden die Teams der „Tatorte“ in Wort und Bild vorgestellt (einschließlich Wohn- und Präsidiumsarchitektur, Wohnverhalten und Blickfang). In einem zweiten Hauptteil werden die „Tatort“-Städte Duisburg, Essen, Frankfurt, Berlin, Münster, München und Hamburg ausführlicher dokumentiert. Einzeltexte gelten u.a. speziellen „Tatort“-Gebäuden, den Szenenbildnerinnen im „Tatort“, der frauenbewegten Spurensuche in Frankfurt und Bremen, den Orten des Bösen, wo getötet wird und den Kommissarswohnungen als Charakterzeichnungen. Zehn Fragen werden von Mehmet Kurtulus, Stefan Konarske, Andres Hoppe und Adele Neuhauser beantwortet. Dominik Graf äußert sich in einem Gespräch über die Räumlichkeit der Spannung. Die Druckqualität des Buches ist hervorragend, die Texte (Autoren: Oliver Elser, Alexander Gutzmer, Udo Wachtveitl, Guido Walter) sind intelligent und fördern zum Teil überraschende Erkenntnisse zutage. Mehr zum Buch: www.callwey.de/buecher/schauplatz-tatort/
Gestrige Tages-meldung: Meret Becker bildet zusammen mit Mark Waschke das neue Er-mittlerpaar im rbb-„Tatort“. Das gefällt mir gut, weil ich Meret seit ihrer Schulzeit kenne und als Schau-spielerin besonders schätze. – Im Münchner Callwey-Verlag ist kürzlich ein großes und sehr schönes Buch über die „Tatort“-Reihe erschienen. Sein Untertitel: „Die Architektur, der Film und der Tod“. Zunächst werden die Teams der „Tatorte“ in Wort und Bild vorgestellt (einschließlich Wohn- und Präsidiumsarchitektur, Wohnverhalten und Blickfang). In einem zweiten Hauptteil werden die „Tatort“-Städte Duisburg, Essen, Frankfurt, Berlin, Münster, München und Hamburg ausführlicher dokumentiert. Einzeltexte gelten u.a. speziellen „Tatort“-Gebäuden, den Szenenbildnerinnen im „Tatort“, der frauenbewegten Spurensuche in Frankfurt und Bremen, den Orten des Bösen, wo getötet wird und den Kommissarswohnungen als Charakterzeichnungen. Zehn Fragen werden von Mehmet Kurtulus, Stefan Konarske, Andres Hoppe und Adele Neuhauser beantwortet. Dominik Graf äußert sich in einem Gespräch über die Räumlichkeit der Spannung. Die Druckqualität des Buches ist hervorragend, die Texte (Autoren: Oliver Elser, Alexander Gutzmer, Udo Wachtveitl, Guido Walter) sind intelligent und fördern zum Teil überraschende Erkenntnisse zutage. Mehr zum Buch: www.callwey.de/buecher/schauplatz-tatort/
12. Februar 2014
Wagner und das Kino der Dekadenz
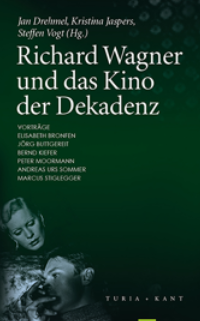 Ein schöner Nachklang des Wagner-Jahres, auch wenn inzwischen schon das Richard Strauss-Jahr begonnen hat: bei Turia + Kant wurden jetzt die Vorträge publiziert, die im April 2013 bei einem Symposium zur Veranstaltungsreihe „Wagner Kino“ im Zeughauskino gehalten worden sind. Dass ihre Lektüre zusätzlichen Gewinn bringt, war mir schon klar, als ich die Vorträge gehört habe. Der Philosophie-Professor Andreas Urs Sommer (Freiburg) setzt sich mit Nietzsche, Wagner und der Dekadenz auseinander. Der Filmhistoriker Bernd Kiefer (Mainz) bringt Wagner in eine sehr reflektierte Beziehung zu den Untergangsfantasien und Verfallsgeschichten von Luchino Visconti und Hans-Jürgen Syberberg. Peter Moormann, inzwischen Professor am Institut für Musikpädagogik der Universität Köln, unternimmt eine sehr sachkundige Entdeckung von Wagners Klangwelten im Fantasyfilm. Von Elisabeth Bronfen (Zürich) stammt ein neuer Essay über „Hollywoods Wagner“ mit analytischen Verweisen auf HI DOODLE DIDDLE (1943) von Andrew I. Stone, VERTIGO (1958) von Alfred Hitchcock, PANDORA AND THE FLYING DUTCHMAN (1951) von Albert Lewin und THE LADY EVE (1941) von Preston Sturges. Und Jörg Buttgereit (Berlin) führt ein sehr substantielles Gespräch mit Marcus Stiglegger (Siegen) über Wagnerianische Monsterfilmsound-tracks von Akira Ifukube. Den Abschluss des Bandes, den Jan Drehmel, Kristina Jaspers und Steffen Vogt herausgegeben haben, bildet eine Medieninstallation zum Thema „Wagner Kino“, die in der Akademie der Künste zu sehen war. Mehr zum Buch: www.turia.at/titel/wagnerkino.html
Ein schöner Nachklang des Wagner-Jahres, auch wenn inzwischen schon das Richard Strauss-Jahr begonnen hat: bei Turia + Kant wurden jetzt die Vorträge publiziert, die im April 2013 bei einem Symposium zur Veranstaltungsreihe „Wagner Kino“ im Zeughauskino gehalten worden sind. Dass ihre Lektüre zusätzlichen Gewinn bringt, war mir schon klar, als ich die Vorträge gehört habe. Der Philosophie-Professor Andreas Urs Sommer (Freiburg) setzt sich mit Nietzsche, Wagner und der Dekadenz auseinander. Der Filmhistoriker Bernd Kiefer (Mainz) bringt Wagner in eine sehr reflektierte Beziehung zu den Untergangsfantasien und Verfallsgeschichten von Luchino Visconti und Hans-Jürgen Syberberg. Peter Moormann, inzwischen Professor am Institut für Musikpädagogik der Universität Köln, unternimmt eine sehr sachkundige Entdeckung von Wagners Klangwelten im Fantasyfilm. Von Elisabeth Bronfen (Zürich) stammt ein neuer Essay über „Hollywoods Wagner“ mit analytischen Verweisen auf HI DOODLE DIDDLE (1943) von Andrew I. Stone, VERTIGO (1958) von Alfred Hitchcock, PANDORA AND THE FLYING DUTCHMAN (1951) von Albert Lewin und THE LADY EVE (1941) von Preston Sturges. Und Jörg Buttgereit (Berlin) führt ein sehr substantielles Gespräch mit Marcus Stiglegger (Siegen) über Wagnerianische Monsterfilmsound-tracks von Akira Ifukube. Den Abschluss des Bandes, den Jan Drehmel, Kristina Jaspers und Steffen Vogt herausgegeben haben, bildet eine Medieninstallation zum Thema „Wagner Kino“, die in der Akademie der Künste zu sehen war. Mehr zum Buch: www.turia.at/titel/wagnerkino.html
11. Februar 2014
Kino und Geschichte bei Kracauer
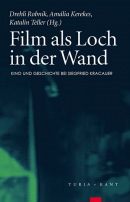 Vor 125 Jahren, im Februar 1889, wurde er geboren, vor 48 Jahren, im November 1966, ist er gestorben. Siegfried Kracauer war Filmkritiker, Theoretiker und Geschichts-philosoph. Vor allem zwei seiner Bücher haben Spuren in der Filmgeschichtsschrei-bung hinterlassen: „Von Caligari zu Hitler“ (zuerst erschienen 1947) und „Theorie des Films“ (1960). Das jetzt vorliegende Buch „Film als Loch in der Wand“ basiert auf einem Workshop, der im November 2009 in Budapest und Wien stattfand. 13 Texte sind hier versammelt, beginnend mit Heide Schlüpmanns sehr reflektierten und informativen Essay über Kracauers politischen Humanismus und die Filmwissenschaft, der einen Bogen von den 1920er Jahren bis in die Gegenwart schlägt. Ich nenne noch vier andere Beiträge, die mir besonders gefallen haben: die Überlegungen von János Weiss über Kracauers frühe filmtheoretische Reflexionen mit seiner fast euphorischen Kritik zu Karl Grunes DIE STRASSE (1923); Amália Kerekes’ Gedanken zum Begriff der Episode bei Béla Balázs und Kracauer; die Thesen von Philippe Despoix zur Geschichtsschreibung im Zeitalter fotografischer und filmischer Reproduzierbarkeit; und Siegfried Mattls Text über das Bild der Vergangenheit bei Siegfried Kracauer. In mehreren Beiträgen steht Kracauers letztes, posthum veröffentlichtes Buch, „Geschichte. Vor den letzten Dingen“ (1969), im Mittelpunkt, das ich nicht gelesen habe. Ich finde es wichtig, dass die Auseinandersetzung mit Kracauer auch in der Gegenwart stattfindet. Mehr zum Buch: www.turia.at/titel/kracauer.html
Vor 125 Jahren, im Februar 1889, wurde er geboren, vor 48 Jahren, im November 1966, ist er gestorben. Siegfried Kracauer war Filmkritiker, Theoretiker und Geschichts-philosoph. Vor allem zwei seiner Bücher haben Spuren in der Filmgeschichtsschrei-bung hinterlassen: „Von Caligari zu Hitler“ (zuerst erschienen 1947) und „Theorie des Films“ (1960). Das jetzt vorliegende Buch „Film als Loch in der Wand“ basiert auf einem Workshop, der im November 2009 in Budapest und Wien stattfand. 13 Texte sind hier versammelt, beginnend mit Heide Schlüpmanns sehr reflektierten und informativen Essay über Kracauers politischen Humanismus und die Filmwissenschaft, der einen Bogen von den 1920er Jahren bis in die Gegenwart schlägt. Ich nenne noch vier andere Beiträge, die mir besonders gefallen haben: die Überlegungen von János Weiss über Kracauers frühe filmtheoretische Reflexionen mit seiner fast euphorischen Kritik zu Karl Grunes DIE STRASSE (1923); Amália Kerekes’ Gedanken zum Begriff der Episode bei Béla Balázs und Kracauer; die Thesen von Philippe Despoix zur Geschichtsschreibung im Zeitalter fotografischer und filmischer Reproduzierbarkeit; und Siegfried Mattls Text über das Bild der Vergangenheit bei Siegfried Kracauer. In mehreren Beiträgen steht Kracauers letztes, posthum veröffentlichtes Buch, „Geschichte. Vor den letzten Dingen“ (1969), im Mittelpunkt, das ich nicht gelesen habe. Ich finde es wichtig, dass die Auseinandersetzung mit Kracauer auch in der Gegenwart stattfindet. Mehr zum Buch: www.turia.at/titel/kracauer.html
08. Februar 2014
Scenario 8
 Dies ist nun schon der achte Band des Film- und Drehbuchalmanachs, und der Heraus-geber, unser Freund Jochen Brunow, verweist in seinem Vorwort auf die vielfältige Symbolik der Zahl acht, auch in ferneren Kulturkreisen. Sein Werkstattgespräch mit dem Autor und Regisseur Alexander Adolph („Über Wahrheit und Lüge“) hat ein hohes Niveau und ist in vieler Hinsicht informativ. Sebastian Heeg, Drehbuch-Absolvent der Ludwigsburger Filmakademie, rekapituliert persönliche Lebensmomente, die mit dem Schreiben zu tun hatten (muss aber noch lernen, wie man Brechts Vornamen schreibt). Stammautor Keith Cunningham reflektiert über das Storytelling in Ost und West und geht dabei weit in die Geschichten zurück. Jochen Brunow unternimmt eine Rückblende in die Geschichte des Märchens als Vorlage filmischen Erzählens (alle Abbildungen stammen von Lotte Reiniger). Oliver Schütte macht einen Streifzug durch die Pixar-Welten. Bei der Backstory geht es diesmal um Jurek Becker, mit zwei Texten aus dem Nachlass und einem sehr schönen Essay von Michael Töteberg. Fünf Lesezeichen machen auf interessante Bücher aufmerksam: auf die von Wolfgang Jacobsen und Heike Klapdor herausgegebene Anthologie „In der Ferne das Glück“ (enthusiastisch besprochen von Thomas Knauf), auf Patrick Roths „Die amerikanische Fahrt“ (mein Filmbuch des Monats August 2013, rezensiert von Manuela Reichart), auf Guido Erol Öztanils Buch über Arno Schmidt und das Kino (Text: Michael Töteberg), auf die sehr schöne englische Publikation „FilmCraft: Screenwriting“ von Tim Grierson (Friederike Gralle) und auf den Roman „Ein Sonntag auf dem Lande“ von Pierre Bost (Manuela Reichart). Das Drehbuch des Jahres stammt von Thomas Franke, hat den Titel „Pizza Kabul“ und wurde gestern von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters ausgezeichnet. Für Jochen beginnt morgen die Arbeit an „Scenario 9“. Mehr zum Buch: http://www.bertz-fischer.de/scenario8.html
Dies ist nun schon der achte Band des Film- und Drehbuchalmanachs, und der Heraus-geber, unser Freund Jochen Brunow, verweist in seinem Vorwort auf die vielfältige Symbolik der Zahl acht, auch in ferneren Kulturkreisen. Sein Werkstattgespräch mit dem Autor und Regisseur Alexander Adolph („Über Wahrheit und Lüge“) hat ein hohes Niveau und ist in vieler Hinsicht informativ. Sebastian Heeg, Drehbuch-Absolvent der Ludwigsburger Filmakademie, rekapituliert persönliche Lebensmomente, die mit dem Schreiben zu tun hatten (muss aber noch lernen, wie man Brechts Vornamen schreibt). Stammautor Keith Cunningham reflektiert über das Storytelling in Ost und West und geht dabei weit in die Geschichten zurück. Jochen Brunow unternimmt eine Rückblende in die Geschichte des Märchens als Vorlage filmischen Erzählens (alle Abbildungen stammen von Lotte Reiniger). Oliver Schütte macht einen Streifzug durch die Pixar-Welten. Bei der Backstory geht es diesmal um Jurek Becker, mit zwei Texten aus dem Nachlass und einem sehr schönen Essay von Michael Töteberg. Fünf Lesezeichen machen auf interessante Bücher aufmerksam: auf die von Wolfgang Jacobsen und Heike Klapdor herausgegebene Anthologie „In der Ferne das Glück“ (enthusiastisch besprochen von Thomas Knauf), auf Patrick Roths „Die amerikanische Fahrt“ (mein Filmbuch des Monats August 2013, rezensiert von Manuela Reichart), auf Guido Erol Öztanils Buch über Arno Schmidt und das Kino (Text: Michael Töteberg), auf die sehr schöne englische Publikation „FilmCraft: Screenwriting“ von Tim Grierson (Friederike Gralle) und auf den Roman „Ein Sonntag auf dem Lande“ von Pierre Bost (Manuela Reichart). Das Drehbuch des Jahres stammt von Thomas Franke, hat den Titel „Pizza Kabul“ und wurde gestern von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters ausgezeichnet. Für Jochen beginnt morgen die Arbeit an „Scenario 9“. Mehr zum Buch: http://www.bertz-fischer.de/scenario8.html
Heute ist der 125. Geburtstag des Filmtheoretikers Siegfried Kracauer. Ich komme demnächst anlässlich einer neuen Publikation auf ihn zurück.
07. Februar 2014
Ästhetik der Schatten
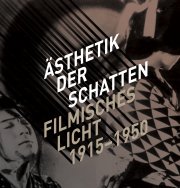 In der Retrospektive geht es in diesem Jahr um das „Filmische Licht 1915-1950“. Wieder ist das MoMA Partner der Deutschen Kinemathek. Gezeigt werden 33 lange und fünf kurze Filme, vorzugsweise aus Deutschland, Japan (darunter SONO YO NO TSUMA, 1930, von Yasujiro Ozu) und den USA. Der Katalog zur Retrospektive, herausgegeben von Connie Betz, Julia Pattis und Rainer Rother, ist diesmal im Schüren Verlag erschienen. Daisuke Miyao schreibt darin über die Beleuchtung im japanischen Film von 1920 bis in die 50er Jahre. Kevin Brownlow erinnert an amerikanische Kameramänner der Stummfilmzeit, darunter John F. Seitz, Charles Rosher und Hal Mohr. Von Karl Prümm stammt ein sehr informativer Essay über Eugen Schüfftan und das Hell-Dunkel im frühen deutschen Tonfilm und im französischen Exil. Fabienne Liptay vergleicht das Starlight bei Greta Garbo und Marlene Dietrich in Hollywood. Norbert Schmitz beschäftigt sich mit dem Verhältnis des filmischen Lichts im Avantgardefilm und im Kino, Ralf Forster beschreibt Techniken der Filmbeleuchtung in Deutschland 1915 bis 1931. Connie Betz und Rainer Rother geben in ihrem Einleitungsessay einen Überblick über die Veränderung von Beleuchtungsstrategien. Allen Texten merkt man das Bemühen um differenzierte Genauigkeit an. Hier ein Beispiel aus der wunderbaren Lichtbeschreibung von Karl Prümm zu Marcel Carnés LE QUAI DES BRUMES: „Er (Schüfftan) kreist die Figuren mit Lichtkegeln ein, die aus dem Nichts kommen, überstrahlt die Naturlichter mit einem Kunstlicht aus nicht identifizierbaren Quellen. Das zweite dominante Prinzip wird durch das Reflexionslicht gebildet. Ein starkes Licht wird auf Wände, auf den Boden, auf Teile der Dekoration oder auf Objekte, auf Accessoires gerichtet, die das Licht sammeln und zurückwerfen und wie ein Spiegel eingesetzt werden. Bei der Ausleuchtung der Akteure legt Schüfftan meist das Licht neben den Körper (…).“ Fast jeder Satz zu Carnés Film auf fünf Buchseiten ließe sich mit Gewinn zitieren. Hier korrespondieren die Abbildungen auch mit den Erkenntnissen des Textes. Mehr zum Buch: filmisches-licht-1915-1950.html
In der Retrospektive geht es in diesem Jahr um das „Filmische Licht 1915-1950“. Wieder ist das MoMA Partner der Deutschen Kinemathek. Gezeigt werden 33 lange und fünf kurze Filme, vorzugsweise aus Deutschland, Japan (darunter SONO YO NO TSUMA, 1930, von Yasujiro Ozu) und den USA. Der Katalog zur Retrospektive, herausgegeben von Connie Betz, Julia Pattis und Rainer Rother, ist diesmal im Schüren Verlag erschienen. Daisuke Miyao schreibt darin über die Beleuchtung im japanischen Film von 1920 bis in die 50er Jahre. Kevin Brownlow erinnert an amerikanische Kameramänner der Stummfilmzeit, darunter John F. Seitz, Charles Rosher und Hal Mohr. Von Karl Prümm stammt ein sehr informativer Essay über Eugen Schüfftan und das Hell-Dunkel im frühen deutschen Tonfilm und im französischen Exil. Fabienne Liptay vergleicht das Starlight bei Greta Garbo und Marlene Dietrich in Hollywood. Norbert Schmitz beschäftigt sich mit dem Verhältnis des filmischen Lichts im Avantgardefilm und im Kino, Ralf Forster beschreibt Techniken der Filmbeleuchtung in Deutschland 1915 bis 1931. Connie Betz und Rainer Rother geben in ihrem Einleitungsessay einen Überblick über die Veränderung von Beleuchtungsstrategien. Allen Texten merkt man das Bemühen um differenzierte Genauigkeit an. Hier ein Beispiel aus der wunderbaren Lichtbeschreibung von Karl Prümm zu Marcel Carnés LE QUAI DES BRUMES: „Er (Schüfftan) kreist die Figuren mit Lichtkegeln ein, die aus dem Nichts kommen, überstrahlt die Naturlichter mit einem Kunstlicht aus nicht identifizierbaren Quellen. Das zweite dominante Prinzip wird durch das Reflexionslicht gebildet. Ein starkes Licht wird auf Wände, auf den Boden, auf Teile der Dekoration oder auf Objekte, auf Accessoires gerichtet, die das Licht sammeln und zurückwerfen und wie ein Spiegel eingesetzt werden. Bei der Ausleuchtung der Akteure legt Schüfftan meist das Licht neben den Körper (…).“ Fast jeder Satz zu Carnés Film auf fünf Buchseiten ließe sich mit Gewinn zitieren. Hier korrespondieren die Abbildungen auch mit den Erkenntnissen des Textes. Mehr zum Buch: filmisches-licht-1915-1950.html
05. Februar 2014
Dramaturgie und Ästhetik im postmodernen Kino
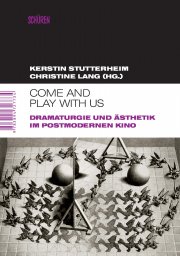 Ein „Vorgespräch“ der beiden Herausgeberinnen, Kerstin Stutterheim (Professorin an der HFF Konrad Wolf in Babelsberg) und Christine Lang (Künstlerisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HFF), eröffnet, sehr lebendig geführt, diesen Band. Und weil sich die HFF an der Praxis orientiert, bewegen sich die Beiträge nicht in einem theoretischen Nirgendwo. Neun Texte sind hier versammelt. Stutterheim definiert zunächst die Postmoderne und lässt dem Überlegungen zur Ästhetik des postmodernen Films folgen. Dann kommt der sehr filmkundige Philosoph und Psychoanalytiker Hinderk M. Emrich zu Wort, der über psychosoziale Perspektiven reflektiert. In sechs Beiträgen geht es um einzelne Filme: über Spiegel in THE BLACK SWAN (2010) von Darren Aronofsky schreibt Michael Geithner, Stutterheim greift noch einmal mit einer Analyse der filmischen Mittel in THE SHINING (1980) von Stanley Kubrick in die Diskussion ein, Eva-Maria Fahmüller beschäftigt sich mit der Dramaturgie in INGLORIOUS BASTERDS (2009) von Quentin Tarantino, Christine Lang untersucht Apichatpong Weerasethakuls SYNDROMES AND A CENTURY (2006) mit seiner dualen Struktur als Beitrag zum postmodernen „Weltkino“, Tobias Wilhelm entdeckt Fassbinders NIKLASHAUSER FART (1970) als Vorläufer der Postmoderne, und bei Karen A. Ritzenhoff geht es um mythische Figuren, Gewalt und Angst in Guillermo del Toros PAN’S LABYRINTH (2006). Nicht nur für Filmstudenten eine lesenswerte Lektüre. Die durchweg farbigen Abbildungen sind manchmal etwas klein geraten. Mehr zum Buch: come-and-play-with-us.html
Ein „Vorgespräch“ der beiden Herausgeberinnen, Kerstin Stutterheim (Professorin an der HFF Konrad Wolf in Babelsberg) und Christine Lang (Künstlerisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HFF), eröffnet, sehr lebendig geführt, diesen Band. Und weil sich die HFF an der Praxis orientiert, bewegen sich die Beiträge nicht in einem theoretischen Nirgendwo. Neun Texte sind hier versammelt. Stutterheim definiert zunächst die Postmoderne und lässt dem Überlegungen zur Ästhetik des postmodernen Films folgen. Dann kommt der sehr filmkundige Philosoph und Psychoanalytiker Hinderk M. Emrich zu Wort, der über psychosoziale Perspektiven reflektiert. In sechs Beiträgen geht es um einzelne Filme: über Spiegel in THE BLACK SWAN (2010) von Darren Aronofsky schreibt Michael Geithner, Stutterheim greift noch einmal mit einer Analyse der filmischen Mittel in THE SHINING (1980) von Stanley Kubrick in die Diskussion ein, Eva-Maria Fahmüller beschäftigt sich mit der Dramaturgie in INGLORIOUS BASTERDS (2009) von Quentin Tarantino, Christine Lang untersucht Apichatpong Weerasethakuls SYNDROMES AND A CENTURY (2006) mit seiner dualen Struktur als Beitrag zum postmodernen „Weltkino“, Tobias Wilhelm entdeckt Fassbinders NIKLASHAUSER FART (1970) als Vorläufer der Postmoderne, und bei Karen A. Ritzenhoff geht es um mythische Figuren, Gewalt und Angst in Guillermo del Toros PAN’S LABYRINTH (2006). Nicht nur für Filmstudenten eine lesenswerte Lektüre. Die durchweg farbigen Abbildungen sind manchmal etwas klein geraten. Mehr zum Buch: come-and-play-with-us.html
04. Februar 2014
Edgar G. Ulmer
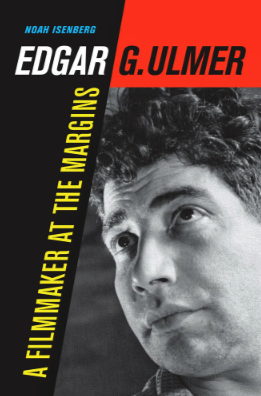 Seine Filmografie nennt rund fünfzig Titel, an denen er beteiligt war. Manchmal lautet die Einschränkung „uncredited“. Edgar G. Ulmer (1904-1972) war ein interessanter, ist aber ein wenig bekannter Regisseur. „Mann im Schatten“ hieß die Biografie, die Stefan Grissemann 2003 über ihn publiziert hat (Zsolnay Verlag). Sie war hervorragend recherchiert und versuchte, Ulmers Bedeutung für die Filmgeschichte neu zu definieren. Das ist ihr nicht wirklich gelungen. Gut zehn Jahre später unternimmt der amerikanische Filmhistoriker Noah Isenberg einen neuen Versuch, diesmal auf internationaler Ebene. Auch sein Titel ist relativierend: „A Filmmaker at the Margins“. Die Verfügbarkeit der Ulmer-Filme ist gestiegen, es gibt sie fast alle auf DVD, Isenberg ist mit ihnen bestens vertraut. Er verknüpft diese Kenntnis mit Dokumenten zu Produktion und Rezeption. Daraus entsteht ein sehr präzises Bild der Arbeit von Edgar Ulmer vor allem im Bereich der B-Movies und der wechselvollen Genreproduktionen außerhalb der großen Studios. So kann man nur hoffen, dass auch eine Neugierde auf Ulmer-Filme jenseits der bekannten (MENSCHEN AM SONNTAG, THE BLACK CAT, DETOUR) entsteht und das Buch seine Wirkung hat. 32 Abbildungen von vergleichsweise guter Qualität. Mehr zum Buch: http://noahisenberg.com/?page_id=455
Seine Filmografie nennt rund fünfzig Titel, an denen er beteiligt war. Manchmal lautet die Einschränkung „uncredited“. Edgar G. Ulmer (1904-1972) war ein interessanter, ist aber ein wenig bekannter Regisseur. „Mann im Schatten“ hieß die Biografie, die Stefan Grissemann 2003 über ihn publiziert hat (Zsolnay Verlag). Sie war hervorragend recherchiert und versuchte, Ulmers Bedeutung für die Filmgeschichte neu zu definieren. Das ist ihr nicht wirklich gelungen. Gut zehn Jahre später unternimmt der amerikanische Filmhistoriker Noah Isenberg einen neuen Versuch, diesmal auf internationaler Ebene. Auch sein Titel ist relativierend: „A Filmmaker at the Margins“. Die Verfügbarkeit der Ulmer-Filme ist gestiegen, es gibt sie fast alle auf DVD, Isenberg ist mit ihnen bestens vertraut. Er verknüpft diese Kenntnis mit Dokumenten zu Produktion und Rezeption. Daraus entsteht ein sehr präzises Bild der Arbeit von Edgar Ulmer vor allem im Bereich der B-Movies und der wechselvollen Genreproduktionen außerhalb der großen Studios. So kann man nur hoffen, dass auch eine Neugierde auf Ulmer-Filme jenseits der bekannten (MENSCHEN AM SONNTAG, THE BLACK CAT, DETOUR) entsteht und das Buch seine Wirkung hat. 32 Abbildungen von vergleichsweise guter Qualität. Mehr zum Buch: http://noahisenberg.com/?page_id=455
02. Februar 2014
James Benning
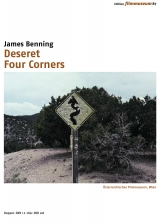 Das Österreichische Filmmuseum kümmert sich in hervorragender Weise um das Werk von James Benning (*1942). In der DVD-Reihe der „Edition Filmmuseum“ sind jetzt die Filme DESERET (1995) und FOUR CORNERS (1997) erschienen. Es ist die vierte Benning-DVD der Reihe. Seine Filme zeigen Landschaften, Bauwerke, Orte, meist im Südwesten der USA. Er hat ein sehr spezielles Interesse an den Bildern und am Ton. DESERET, 78 min., ist die Geschichte des Mormonen-Staates Utah, die Tonzitate stammen aus der New York Times, die Bilder sind in Schwarzweiß und Farbe fotografiert. Sie haben eine überwältigende Tiefe. FOUR CORNERS, 76 min., ist eine Hommage an das Vier-Länder-Eck, an dem die Staaten Colorado, New Mexico, Arizona und Utah aufeinander treffen. Und es ist auch ein Porträtfilm über vier sehr unterschiedliche Künstler: über den Impressionist Claude Monet, den afroamerikanischen Volkskünstler Moses Tolliver, die fiktive indianische Wandbild-Malerin „Yukawa“ und den amerikanischen Maler und Popart-Künstler Jaspers Johns. Als Sprecher fungieren Hartmut Bitomsky, James Benning, Yeasup Song und Billy Woodberry. Jeder Text besteht dabei aus der gleichen Anzahl von Worten. Zu den beiden DVDs gehören ein Booklet mit einem Text von Neil Young und die Aufnahme eines Publikumsgesprächs mit Benning bei der Viennale 1996 (15 min.) Das Österreichische Filmmuseum hat 2007 ein wunderbares Buch über James Benning publiziert: VswBzGInU . Mehr zur DVD: Deseret—Four-Corners.html
Das Österreichische Filmmuseum kümmert sich in hervorragender Weise um das Werk von James Benning (*1942). In der DVD-Reihe der „Edition Filmmuseum“ sind jetzt die Filme DESERET (1995) und FOUR CORNERS (1997) erschienen. Es ist die vierte Benning-DVD der Reihe. Seine Filme zeigen Landschaften, Bauwerke, Orte, meist im Südwesten der USA. Er hat ein sehr spezielles Interesse an den Bildern und am Ton. DESERET, 78 min., ist die Geschichte des Mormonen-Staates Utah, die Tonzitate stammen aus der New York Times, die Bilder sind in Schwarzweiß und Farbe fotografiert. Sie haben eine überwältigende Tiefe. FOUR CORNERS, 76 min., ist eine Hommage an das Vier-Länder-Eck, an dem die Staaten Colorado, New Mexico, Arizona und Utah aufeinander treffen. Und es ist auch ein Porträtfilm über vier sehr unterschiedliche Künstler: über den Impressionist Claude Monet, den afroamerikanischen Volkskünstler Moses Tolliver, die fiktive indianische Wandbild-Malerin „Yukawa“ und den amerikanischen Maler und Popart-Künstler Jaspers Johns. Als Sprecher fungieren Hartmut Bitomsky, James Benning, Yeasup Song und Billy Woodberry. Jeder Text besteht dabei aus der gleichen Anzahl von Worten. Zu den beiden DVDs gehören ein Booklet mit einem Text von Neil Young und die Aufnahme eines Publikumsgesprächs mit Benning bei der Viennale 1996 (15 min.) Das Österreichische Filmmuseum hat 2007 ein wunderbares Buch über James Benning publiziert: VswBzGInU . Mehr zur DVD: Deseret—Four-Corners.html
30. Januar 2014
German Cinema: Terror and Trauma
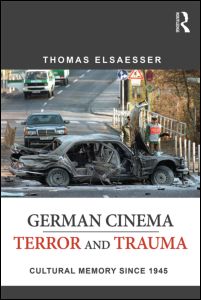 Thomas Elsaesser (*1943), inzwischen emeritierter Pro-fessor für Film- und Fernseh-wissenschaften an der Univer-sität Amsterdam, hat zwei Forschungsschwerpunkte: den deutschen und den amerikani-schen Film. In den Epochen ist er nicht festgelegt, ich schätze sehr seine Publikationen über den „Neuen Deutschen Film“ (1994), „Das Weimarer Kino – aufgeklärt und doppelbödig“ (1999), „Filmgeschichte und frühes Kino“ (2002), aber auch über „Hollywood heute“ (Bertz + Fischer 2009). 2007 erschien bei Kadmos seine Aufsatzsammlung „Terror und Trauma“ über die Gewalt des Vergangenen in der Bundesrepublik. Simon Rothöhler hat damals in der taz eine kluge Rezension des Bandes veröffentlicht: 2007/04/05/a0215. Routledge (New York und London) hat jetzt eine erweiterte Fassung des Buches publiziert: „German Cinema – Terror and Trauma“. Cultural Memory Since 1945“. Neu sind u.a. eine sehr differenzierte Analyse von Konrad Wolfs Film STERNE (1959), der mir viel bedeutet, die Überarbeitung eines Aufsatzes über Fassbinders DIE DRITTE GENERATION (1978/79) und eine Würdigung von Harun Farockis AUFSCHUB/RESPITE (2007). Für die deutsche Filmgeschichte arbeitet Elsaesser auch in den anderen Kapiteln die traumatischen Folgen des Holocaust und der RAF-Bewegung auf, gibt ihnen ein theoretisches Fundament und erweitert den Horizont mit der Perspektive auf die Folgen von 9/11. Die Texte sind immer an konkreten Filmbeispielen orientiert, taugen aber auch zu historiografischen Verallgemeinerungen. Das Buch enthält keine Abbildungen. Titelbild: Foto vom Anschlag auf Alfred Herrhausen in Bad Homburg. Mehr zum Buch: details/9780415709279/
Thomas Elsaesser (*1943), inzwischen emeritierter Pro-fessor für Film- und Fernseh-wissenschaften an der Univer-sität Amsterdam, hat zwei Forschungsschwerpunkte: den deutschen und den amerikani-schen Film. In den Epochen ist er nicht festgelegt, ich schätze sehr seine Publikationen über den „Neuen Deutschen Film“ (1994), „Das Weimarer Kino – aufgeklärt und doppelbödig“ (1999), „Filmgeschichte und frühes Kino“ (2002), aber auch über „Hollywood heute“ (Bertz + Fischer 2009). 2007 erschien bei Kadmos seine Aufsatzsammlung „Terror und Trauma“ über die Gewalt des Vergangenen in der Bundesrepublik. Simon Rothöhler hat damals in der taz eine kluge Rezension des Bandes veröffentlicht: 2007/04/05/a0215. Routledge (New York und London) hat jetzt eine erweiterte Fassung des Buches publiziert: „German Cinema – Terror and Trauma“. Cultural Memory Since 1945“. Neu sind u.a. eine sehr differenzierte Analyse von Konrad Wolfs Film STERNE (1959), der mir viel bedeutet, die Überarbeitung eines Aufsatzes über Fassbinders DIE DRITTE GENERATION (1978/79) und eine Würdigung von Harun Farockis AUFSCHUB/RESPITE (2007). Für die deutsche Filmgeschichte arbeitet Elsaesser auch in den anderen Kapiteln die traumatischen Folgen des Holocaust und der RAF-Bewegung auf, gibt ihnen ein theoretisches Fundament und erweitert den Horizont mit der Perspektive auf die Folgen von 9/11. Die Texte sind immer an konkreten Filmbeispielen orientiert, taugen aber auch zu historiografischen Verallgemeinerungen. Das Buch enthält keine Abbildungen. Titelbild: Foto vom Anschlag auf Alfred Herrhausen in Bad Homburg. Mehr zum Buch: details/9780415709279/
29. Januar 2014
Ernst Lubitsch
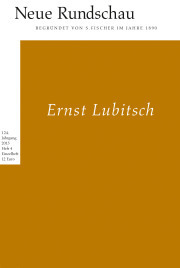 Heute wäre der Schauspieler und Regisseur Ernst Lubitsch 122 Jahre alt geworden. Aber er ist leider schon 1947 gestorben. Ihm waren in den letzten Jahren viele Retro-spektiven gewidmet (zum Beispiel eine vollständige im Berliner Babylon-Kino, zum 60. Todestag, 2007, und eine zusammen mit Werner Richard Heymann im Babylon 2013), es wurden Symposien über ihn veranstaltet (zuletzt im Oktober 2012 von der Slowenischen Kinemathek), und hier und da gibt es auch ein Buch über ihn. Mein eigenes, herausgegeben zusammen mit Enno Patalas, wurde 1984 anlässlich einer Retrospektive der Berlinale publiziert. In der „Neuen Rundschau“ (Heft 4/2013) sind jetzt die Beiträge zum slowenischen Symposium publiziert worden, zehn Texte auf 220 Seiten, die man mit großem Vergnügen und beträchtlichem Erkenntnisgewinn lesen kann. Die programmatische Einführung „Lubitsch kann nicht warten“ stammt von Jela Krečič und Ivana Novak. Aaron Schusters Essay „Die Komödie im Zeitalter der Sparsamkeit“ handelt von der Aufmerksamkeit für Details und den berühmten Auslassungen in TROUBLE IN PARADISE (1932). Auch Russell Grigg konzentriert seinen Beitrag auf diesen Film. „Garbo lacht“ von Tatjana Jukić ist eine Reflexion über Revolution und Melancholie in NINOTCHKA (1939). Bei Mladen Dolar geht es um TO BE OR NOT TO BE. Auch „Lubitschs Krieg“ von Elisabeth Bronfen analysiert diesen Film und entschlüsselt, wie subtil Lubitsch 1941, als der Film gedreht wurde, Amerikas Eingreifen in den Weltkrieg mitinszeniert. Mladen Moder deutet die (falschen) Bärte in TO BE… als Phallussymbole. Alenka Zupančič schreibt sehr differenziert über Lubitschs letzten Film CLUNY BROWN (1946). Den Abschluss bildet Slavoj Žižeks philosophischer Diskurs über die generelle Bedeutung des „Ärgers im Paradies“ mit vielen Lubitsch-Filmbeispielen, inklusive der berühmten Eingangssequenz von DIE PUPPE (1919). Mehr zur Publikation: neue_rundschau_2013_4/9783108090951
Heute wäre der Schauspieler und Regisseur Ernst Lubitsch 122 Jahre alt geworden. Aber er ist leider schon 1947 gestorben. Ihm waren in den letzten Jahren viele Retro-spektiven gewidmet (zum Beispiel eine vollständige im Berliner Babylon-Kino, zum 60. Todestag, 2007, und eine zusammen mit Werner Richard Heymann im Babylon 2013), es wurden Symposien über ihn veranstaltet (zuletzt im Oktober 2012 von der Slowenischen Kinemathek), und hier und da gibt es auch ein Buch über ihn. Mein eigenes, herausgegeben zusammen mit Enno Patalas, wurde 1984 anlässlich einer Retrospektive der Berlinale publiziert. In der „Neuen Rundschau“ (Heft 4/2013) sind jetzt die Beiträge zum slowenischen Symposium publiziert worden, zehn Texte auf 220 Seiten, die man mit großem Vergnügen und beträchtlichem Erkenntnisgewinn lesen kann. Die programmatische Einführung „Lubitsch kann nicht warten“ stammt von Jela Krečič und Ivana Novak. Aaron Schusters Essay „Die Komödie im Zeitalter der Sparsamkeit“ handelt von der Aufmerksamkeit für Details und den berühmten Auslassungen in TROUBLE IN PARADISE (1932). Auch Russell Grigg konzentriert seinen Beitrag auf diesen Film. „Garbo lacht“ von Tatjana Jukić ist eine Reflexion über Revolution und Melancholie in NINOTCHKA (1939). Bei Mladen Dolar geht es um TO BE OR NOT TO BE. Auch „Lubitschs Krieg“ von Elisabeth Bronfen analysiert diesen Film und entschlüsselt, wie subtil Lubitsch 1941, als der Film gedreht wurde, Amerikas Eingreifen in den Weltkrieg mitinszeniert. Mladen Moder deutet die (falschen) Bärte in TO BE… als Phallussymbole. Alenka Zupančič schreibt sehr differenziert über Lubitschs letzten Film CLUNY BROWN (1946). Den Abschluss bildet Slavoj Žižeks philosophischer Diskurs über die generelle Bedeutung des „Ärgers im Paradies“ mit vielen Lubitsch-Filmbeispielen, inklusive der berühmten Eingangssequenz von DIE PUPPE (1919). Mehr zur Publikation: neue_rundschau_2013_4/9783108090951