30. Mai 2014
Erzählstimmen im aktuellen Film
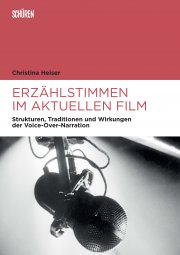 Dies ist eine höchst spannende Dissertation aus Marburg, fachlich betreut von Prof. Karl Prümm. Über die Voice-Over-Narration wurde zwar hier und da geschrieben, aber sie stand noch nie im Mittelpunkt einer großen Untersuchung. Und auch wenn der Titel von Christina Heisers Buch auf „Erzählstimmen im aktuellen Film“ ausgerichtet ist, gibt es viel Raum für die Geschichte des Voice-Over. Kleinere Kapitel handeln zunächst vom Ton im Stummfilm, von den Vorbehalten gegenüber der Sprache im Film, von den Kommentaren in der Wochenschau, im Dokumentar- und Propagandafilm. Längere Passagen gelten Orson Welles und der Voice-Over-Narration, dem Film SUNSET BOULEVARD, der Verwendung von Erzählstimmen im amerikanischen Kino bis 1960, in der Nouvelle Vague und im Neuen Deutschen Film, im New Hollywood-Film (TAXI DRIVER), in APOCALYPSE NOW und im Blockbuster-Kino der 1980er und 90er Jahre. Das erste Kapitel („Voice-Over-Narration in der Filmgeschichte“) umfasst immerhin mehr als 100 Seiten. Das zweite Kapitel („Die Funktionsebenen der Voice-Over-Narration“) geht theoretisch in die Tiefe, handelt von den Funktionen des Tons, von psycho-akustischen Aspekten der filmischen Narration und den Grundlagen des Narrativen. Auch dies geschieht auf mehr als 100 Seiten. Dann geht es um den aktuellen Film. Die Beispiele sind u.a. LE FABULEUX DESTIN D’AMELIE POULAIN von Jean-Pierre Jeunet, FIGHT CLUB von David Fincher und MEMENTO von Christopher Nolan. Ein eigenes Kapitel ist der Emanzipation der weiblichen Stimme gewidmet. Hervorragend ist die Analyse des Films ADAPTATION (2002) von Spike Jonze und seiner Erzählstruktur. Die Filmliste am Ende des Bandes enthält rund 280 Titel. Die Abbildungen sind sparsam über das Buch verteilt und relativ klein, sie haben eher Erinnerungscharakter. Mehr zum Buch: erzaehlstimmen-im-aktuellen-film.html
Dies ist eine höchst spannende Dissertation aus Marburg, fachlich betreut von Prof. Karl Prümm. Über die Voice-Over-Narration wurde zwar hier und da geschrieben, aber sie stand noch nie im Mittelpunkt einer großen Untersuchung. Und auch wenn der Titel von Christina Heisers Buch auf „Erzählstimmen im aktuellen Film“ ausgerichtet ist, gibt es viel Raum für die Geschichte des Voice-Over. Kleinere Kapitel handeln zunächst vom Ton im Stummfilm, von den Vorbehalten gegenüber der Sprache im Film, von den Kommentaren in der Wochenschau, im Dokumentar- und Propagandafilm. Längere Passagen gelten Orson Welles und der Voice-Over-Narration, dem Film SUNSET BOULEVARD, der Verwendung von Erzählstimmen im amerikanischen Kino bis 1960, in der Nouvelle Vague und im Neuen Deutschen Film, im New Hollywood-Film (TAXI DRIVER), in APOCALYPSE NOW und im Blockbuster-Kino der 1980er und 90er Jahre. Das erste Kapitel („Voice-Over-Narration in der Filmgeschichte“) umfasst immerhin mehr als 100 Seiten. Das zweite Kapitel („Die Funktionsebenen der Voice-Over-Narration“) geht theoretisch in die Tiefe, handelt von den Funktionen des Tons, von psycho-akustischen Aspekten der filmischen Narration und den Grundlagen des Narrativen. Auch dies geschieht auf mehr als 100 Seiten. Dann geht es um den aktuellen Film. Die Beispiele sind u.a. LE FABULEUX DESTIN D’AMELIE POULAIN von Jean-Pierre Jeunet, FIGHT CLUB von David Fincher und MEMENTO von Christopher Nolan. Ein eigenes Kapitel ist der Emanzipation der weiblichen Stimme gewidmet. Hervorragend ist die Analyse des Films ADAPTATION (2002) von Spike Jonze und seiner Erzählstruktur. Die Filmliste am Ende des Bandes enthält rund 280 Titel. Die Abbildungen sind sparsam über das Buch verteilt und relativ klein, sie haben eher Erinnerungscharakter. Mehr zum Buch: erzaehlstimmen-im-aktuellen-film.html
29. Mai 2014
Peter Lorre
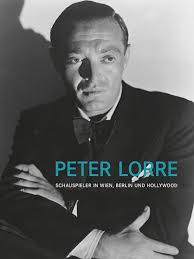 Zum 50. Todestag des Schau-spielers Peter Lorre im März hat Synema in Wien eine kleine, aber sehr lesenswerte Broschüre publiziert. Brigitte Mayr und Michael Omasta stimmen mit ihrer „Hommage“ auf den Ton ein. Von Peter Nau gibt es eine seiner bekannten Faksimile-Seiten mit einer präzisen Darstellung des Endes von M. Brigitte Mayr schreibt dann über Lorres Debüt im österreichischen Kino in den Filmen DIE VERSCHWUN-DENE FRAU und DIE DAME AUF DER BANKNOTE, beide aus dem Jahr 1929, Regie: Karl Leiter. Zwei interessante Dokumente sind der Text von Pem. (Paul Erich Marcus) über ein Telefonat mit Lorre 1934, als der in Hollywood ein Vertragsangebot bekam, und die Erinnerung von Curt Siodmak an Lorre aus dem Jahr 1993; Siodmak war der Autor des Lorre-Films THE BEAST WITH THE FIVE FINGERS (1946). Michael Omasta thematisiert die Stimme von Lorre als Rundfunksprecher. Der längste Text stammt von Lutz Koepnick und reflektiert über die Exil-Zeit von Lorre. Romuald Karmakar hat ein kurzes Statement über Lorre als „Verlorenen des deutschen Films“ beigesteuert. Eine Filmliste und eine Lebenschronik runden die Publikation ab. Wirklich: eine Hommage. Mehr dazu: 519&ss1=y
Zum 50. Todestag des Schau-spielers Peter Lorre im März hat Synema in Wien eine kleine, aber sehr lesenswerte Broschüre publiziert. Brigitte Mayr und Michael Omasta stimmen mit ihrer „Hommage“ auf den Ton ein. Von Peter Nau gibt es eine seiner bekannten Faksimile-Seiten mit einer präzisen Darstellung des Endes von M. Brigitte Mayr schreibt dann über Lorres Debüt im österreichischen Kino in den Filmen DIE VERSCHWUN-DENE FRAU und DIE DAME AUF DER BANKNOTE, beide aus dem Jahr 1929, Regie: Karl Leiter. Zwei interessante Dokumente sind der Text von Pem. (Paul Erich Marcus) über ein Telefonat mit Lorre 1934, als der in Hollywood ein Vertragsangebot bekam, und die Erinnerung von Curt Siodmak an Lorre aus dem Jahr 1993; Siodmak war der Autor des Lorre-Films THE BEAST WITH THE FIVE FINGERS (1946). Michael Omasta thematisiert die Stimme von Lorre als Rundfunksprecher. Der längste Text stammt von Lutz Koepnick und reflektiert über die Exil-Zeit von Lorre. Romuald Karmakar hat ein kurzes Statement über Lorre als „Verlorenen des deutschen Films“ beigesteuert. Eine Filmliste und eine Lebenschronik runden die Publikation ab. Wirklich: eine Hommage. Mehr dazu: 519&ss1=y
27. Mai 2014
Grace Kelly
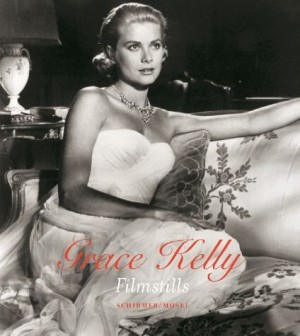 In unseren Kinos ist zur-zeit der Film GRACE OF MONACO zu sehen, und man kann sich natürlich streiten, ob Nicole Kidman wirklich die ideale Kelly-Darstellerin ist. Wenn man sich die Film Stills an-schaut, die gerade in einem neuen Buch bei Schirmer/Mosel zu bewundern sind, spürt man schnell, wie schwer diese Rolle zu besetzen ist. Allein die Fotos haben eine Aura, die zur Bewunderung zwingt. Elf Kinofilme hat Grace Kelly zwischen 1951 und 56 gedreht, darunter HIGH NOON von Fred Zinnemann, MOGAMBO von John Ford, THE COUNTRY GIRL von George Seaton und die drei Hitchcock-Filme DIAL M FOR MURDER, REAR WINDOW und TO CATCH A THIEF. Mit HIGH SOCIETY von Charles Waters hat sie sich aus Hollywood verabschiedet. Von Thilo Wydra, der im vergangenen Jahr bei Aufbau eine Grace Kelly-Biografie publiziert hat, stammt eine sehr sensible und an einzelnen Szenen orientierte Einführung in den Bildband. Die Fotos sind in der Mehrzahl schwarzweiß und drucktechnisch erste Klasse. Zu jedem Film gibt es noch einen separaten Text von Marion Kagerer, und am Ende steht eine Zeittafel mit einem perspektivischen Datum: 12. November 2014 – 85. Geburtstag von Grace Kelly. Leider ist sie schon 1982 nach einem Autounfall gestorben. Mehr zum Buch: Grace_Kelly.pdf
In unseren Kinos ist zur-zeit der Film GRACE OF MONACO zu sehen, und man kann sich natürlich streiten, ob Nicole Kidman wirklich die ideale Kelly-Darstellerin ist. Wenn man sich die Film Stills an-schaut, die gerade in einem neuen Buch bei Schirmer/Mosel zu bewundern sind, spürt man schnell, wie schwer diese Rolle zu besetzen ist. Allein die Fotos haben eine Aura, die zur Bewunderung zwingt. Elf Kinofilme hat Grace Kelly zwischen 1951 und 56 gedreht, darunter HIGH NOON von Fred Zinnemann, MOGAMBO von John Ford, THE COUNTRY GIRL von George Seaton und die drei Hitchcock-Filme DIAL M FOR MURDER, REAR WINDOW und TO CATCH A THIEF. Mit HIGH SOCIETY von Charles Waters hat sie sich aus Hollywood verabschiedet. Von Thilo Wydra, der im vergangenen Jahr bei Aufbau eine Grace Kelly-Biografie publiziert hat, stammt eine sehr sensible und an einzelnen Szenen orientierte Einführung in den Bildband. Die Fotos sind in der Mehrzahl schwarzweiß und drucktechnisch erste Klasse. Zu jedem Film gibt es noch einen separaten Text von Marion Kagerer, und am Ende steht eine Zeittafel mit einem perspektivischen Datum: 12. November 2014 – 85. Geburtstag von Grace Kelly. Leider ist sie schon 1982 nach einem Autounfall gestorben. Mehr zum Buch: Grace_Kelly.pdf
26. Mai 2014
Die Romanvorlage zu WESTFRONT 1918
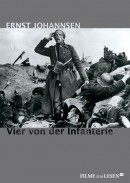 Vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg, daran wird in diesem Jahr immer wieder erinnert. Zu den berühmtesten Filmen über diesen Krieg gehört WESTFRONT 1918 von G. W. Pabst, ein früher Tonfilm aus dem Jahr 1930, der nach dem Roman „Vier von der Infanterie. Ihre letzten Tage an der Westfront 1918“ von Ernst Johannsen gedreht wurde. Johannsen (1898-1977) war Hörspielautor und Schriftsteller, er schrieb mehrere Romane, emigrierte 1939 nach England, kehrte 1957 nach Deutschland zurück und ist inzwischen ziemlich vergessen. Johannsens Roman erschien 1929, wurde wohl viel gelesen, stand aber im Schatten von Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“. Er erzählt sehr authentisch die Erlebnisse von vier Soldaten an der Front, nüchtern, durchaus reflektierend, auch träumend, aber mit tödlichem Ende. Im Buch sind das jetzt 70 Seiten. Dem Roman folgt dann ein analytischer Text von Andre Kagelmann und Reinhold Keiner (35 Seiten) mit Informationen und Überlegungen zum Roman und seiner Verfilmung, kenntnisreich geschrieben und gut strukturiert. Mit zehn Abbildungen wird das Buch optisch geteilt. Erschienen in der Reihe „Filme zum Lesen“. Diese Reihe, herausgegeben von Kagelmann und Keiner, widmet sich literarischen Texten, die Filmklassikern zugrunde liegen oder zugleich mit den Drehbüchern entstanden sind. Dies ist – nach Will Trempers DIE HALBSTARKEN – der zweite Band der Reihe. Mehr zum Buch: eines.html
Vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg, daran wird in diesem Jahr immer wieder erinnert. Zu den berühmtesten Filmen über diesen Krieg gehört WESTFRONT 1918 von G. W. Pabst, ein früher Tonfilm aus dem Jahr 1930, der nach dem Roman „Vier von der Infanterie. Ihre letzten Tage an der Westfront 1918“ von Ernst Johannsen gedreht wurde. Johannsen (1898-1977) war Hörspielautor und Schriftsteller, er schrieb mehrere Romane, emigrierte 1939 nach England, kehrte 1957 nach Deutschland zurück und ist inzwischen ziemlich vergessen. Johannsens Roman erschien 1929, wurde wohl viel gelesen, stand aber im Schatten von Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“. Er erzählt sehr authentisch die Erlebnisse von vier Soldaten an der Front, nüchtern, durchaus reflektierend, auch träumend, aber mit tödlichem Ende. Im Buch sind das jetzt 70 Seiten. Dem Roman folgt dann ein analytischer Text von Andre Kagelmann und Reinhold Keiner (35 Seiten) mit Informationen und Überlegungen zum Roman und seiner Verfilmung, kenntnisreich geschrieben und gut strukturiert. Mit zehn Abbildungen wird das Buch optisch geteilt. Erschienen in der Reihe „Filme zum Lesen“. Diese Reihe, herausgegeben von Kagelmann und Keiner, widmet sich literarischen Texten, die Filmklassikern zugrunde liegen oder zugleich mit den Drehbüchern entstanden sind. Dies ist – nach Will Trempers DIE HALBSTARKEN – der zweite Band der Reihe. Mehr zum Buch: eines.html
25. Mai 2014
Vlado Kristl
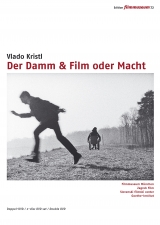 Er war Maler, Poet und Filmemacher. Im westdeutschen Film der 1960er Jahre galt er als der größte Provo-kateur. Vlado Kristl (1923-2004) kam 1963 aus Zagreb nach München. Er hatte bis dahin vier Animationsfilme realisiert. Seinen Film MADELEINE, MADELEINE habe ich in Oberhausen gesehen. Es waren zehn beglückende, verwirrende Minuten, in denen ein hübsches Mädchen Tennisspielen lernt, ein junger Mann durch den Zaun schaut, der Tennislehrer aggressiv wird, zwei Frauen auf dem Platz in Streit geraten, ein Gewitter ausbricht und eine Männerstimme grölt „Ich haaste durch den Wald“. Alle Einstellungen sind zerstückelt, und daraus entsteht ein surrealistischer, beunruhigender Effekt, über den man lachen und staunen kann. Sein erster Langfilm, DER DAMM (1964), wurde von Detten Schleiermacher produziert und fand nicht die notwendige Anerkennung. Auch hier sind die Kontinuitäten der Geschichte formal zerstört. Eine junge Frau im Rollstuhl (Petra Krause, später: Nettelbeck) wird von einem dünnen (Kristl) und einem dicken Mann (Felix Potisk) umworben. Der Dicke gewinnt. In der Tat sind die Montagen der Kristl-Filme ziemlich wahnwitzig. Aber sie haben eine eigene Poesie. Die jetzt in der Edition Filmmuseum erschienene DVD enthält auch das 1970 entstandene Werk FILM ODER MACHT, in dem immerhin Silvia Kékulé, Heinz Badewitz und Wolf Wondraschek mitgewirkt haben. Hauptperson ist Hjalmar-M. „Ringo“ Pretorius, der als Moderator fungiert. Es ist eine Nummernrevue, wieder gegen alle Regeln des Handwerks montiert und mit kleinen Texten gegen die Filmförderung unterlegt. Ein Dokument der Zeit. Die DVD enthält außerdem die vier frühen jugoslawischen Animationsfilme und die Kurzfilme PROMETHEUS (1966), ITALIENISCHES CAPRICCIO (1969) und TIGERKÄFIG (1971). Im ROM-Bereich gibt es Storyboards, Dokumente und Texte. Das Booklet ist sehr informativ. Das Münchner Filmmuseum, das den filmischen Nachlass von Kristl betreut, ist für die Edition verantwortlich. Mehr zur DVD: Der-Damm—Film-oder-Macht.html
Er war Maler, Poet und Filmemacher. Im westdeutschen Film der 1960er Jahre galt er als der größte Provo-kateur. Vlado Kristl (1923-2004) kam 1963 aus Zagreb nach München. Er hatte bis dahin vier Animationsfilme realisiert. Seinen Film MADELEINE, MADELEINE habe ich in Oberhausen gesehen. Es waren zehn beglückende, verwirrende Minuten, in denen ein hübsches Mädchen Tennisspielen lernt, ein junger Mann durch den Zaun schaut, der Tennislehrer aggressiv wird, zwei Frauen auf dem Platz in Streit geraten, ein Gewitter ausbricht und eine Männerstimme grölt „Ich haaste durch den Wald“. Alle Einstellungen sind zerstückelt, und daraus entsteht ein surrealistischer, beunruhigender Effekt, über den man lachen und staunen kann. Sein erster Langfilm, DER DAMM (1964), wurde von Detten Schleiermacher produziert und fand nicht die notwendige Anerkennung. Auch hier sind die Kontinuitäten der Geschichte formal zerstört. Eine junge Frau im Rollstuhl (Petra Krause, später: Nettelbeck) wird von einem dünnen (Kristl) und einem dicken Mann (Felix Potisk) umworben. Der Dicke gewinnt. In der Tat sind die Montagen der Kristl-Filme ziemlich wahnwitzig. Aber sie haben eine eigene Poesie. Die jetzt in der Edition Filmmuseum erschienene DVD enthält auch das 1970 entstandene Werk FILM ODER MACHT, in dem immerhin Silvia Kékulé, Heinz Badewitz und Wolf Wondraschek mitgewirkt haben. Hauptperson ist Hjalmar-M. „Ringo“ Pretorius, der als Moderator fungiert. Es ist eine Nummernrevue, wieder gegen alle Regeln des Handwerks montiert und mit kleinen Texten gegen die Filmförderung unterlegt. Ein Dokument der Zeit. Die DVD enthält außerdem die vier frühen jugoslawischen Animationsfilme und die Kurzfilme PROMETHEUS (1966), ITALIENISCHES CAPRICCIO (1969) und TIGERKÄFIG (1971). Im ROM-Bereich gibt es Storyboards, Dokumente und Texte. Das Booklet ist sehr informativ. Das Münchner Filmmuseum, das den filmischen Nachlass von Kristl betreut, ist für die Edition verantwortlich. Mehr zur DVD: Der-Damm—Film-oder-Macht.html
24. Mai 2014
Lilli Palmer
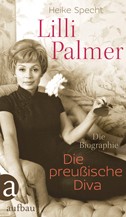 Heute ist der 100. Geburtstag von Lilli Palmer. Sie war einer der großen Stars des westdeutschen Films der 1950er Jahre. In Kurt Hoffmanns FEUERWERK (1954) habe ich sie zum ersten Mal gesehen, aber da war Romy Schneider für mich wichtiger. In Rolf Hansens TEUFEL IN SEIDE und vor allem in Harald Brauns DER GLÄSERNE TURM hat sie mich sehr beeindruckt. Und als sie 1958 im Remake von MÄDCHEN IN UNIFORM Romy Schneiders Partnerin war, fand ich die Konstellation ideal. Über das Leben dieser Schauspielerin, die als Jüdin 1933 emigrieren musste und zunächst in England, dann in den USA Karriere machte, wusste ich damals relativ wenig. 1974 wurde ihre Autobiografie „Dicke Lilli – Gutes Kind“ publiziert. Zum runden Geburtstag der 1986 verstorben Schauspielerin ist jetzt im Aufbau Verlag eine lesenswerte Biografie von Heike Specht erschienen. Sie führt uns in klassischer Chronologie durchs private und berufliche Leben von Lilli Palmer, und da es in diesem Leben viele Brüche gab, fragt die Autorin auch immer wieder nach den Gründen für Ortswechsel und Rollenwahl, am intensivsten bei der Rückkehr nach Deutschland 1954, die auch schnell zur Trennung von ihrem damaligen Ehemann Rex Harrison führte. Es wird zwar häufig aus Palmers Autobiografie zitiert (auch aus der englischen Ausgabe „Change Lobsters and Dance“, die einige andere Schwerpunkte hat), aber die Autorin hat natürlich selbst umfassend recherchiert. So spielt bei ihr Palmers Ehe mit Carlos Thompson eine wichtige Rolle. Und interessant ist die Passage über die Arbeit an dem DEFA-Film LOTTE IN WEIMAR (1974) von Egon Günther; es waren wohl vor allem die häufigen Grenzübertritte zwischen West und Ost, die sie genervt haben; aber auch mit dem Goethe-Darsteller Martin Hellberg hatte sie Probleme. In den späten Jahren lebte Lilli Palmer überwiegend im Schweizer Goldingen und war als Autorin und Malerin tätig. Mehr zum Buch: die-preussische-diva.html
Heute ist der 100. Geburtstag von Lilli Palmer. Sie war einer der großen Stars des westdeutschen Films der 1950er Jahre. In Kurt Hoffmanns FEUERWERK (1954) habe ich sie zum ersten Mal gesehen, aber da war Romy Schneider für mich wichtiger. In Rolf Hansens TEUFEL IN SEIDE und vor allem in Harald Brauns DER GLÄSERNE TURM hat sie mich sehr beeindruckt. Und als sie 1958 im Remake von MÄDCHEN IN UNIFORM Romy Schneiders Partnerin war, fand ich die Konstellation ideal. Über das Leben dieser Schauspielerin, die als Jüdin 1933 emigrieren musste und zunächst in England, dann in den USA Karriere machte, wusste ich damals relativ wenig. 1974 wurde ihre Autobiografie „Dicke Lilli – Gutes Kind“ publiziert. Zum runden Geburtstag der 1986 verstorben Schauspielerin ist jetzt im Aufbau Verlag eine lesenswerte Biografie von Heike Specht erschienen. Sie führt uns in klassischer Chronologie durchs private und berufliche Leben von Lilli Palmer, und da es in diesem Leben viele Brüche gab, fragt die Autorin auch immer wieder nach den Gründen für Ortswechsel und Rollenwahl, am intensivsten bei der Rückkehr nach Deutschland 1954, die auch schnell zur Trennung von ihrem damaligen Ehemann Rex Harrison führte. Es wird zwar häufig aus Palmers Autobiografie zitiert (auch aus der englischen Ausgabe „Change Lobsters and Dance“, die einige andere Schwerpunkte hat), aber die Autorin hat natürlich selbst umfassend recherchiert. So spielt bei ihr Palmers Ehe mit Carlos Thompson eine wichtige Rolle. Und interessant ist die Passage über die Arbeit an dem DEFA-Film LOTTE IN WEIMAR (1974) von Egon Günther; es waren wohl vor allem die häufigen Grenzübertritte zwischen West und Ost, die sie genervt haben; aber auch mit dem Goethe-Darsteller Martin Hellberg hatte sie Probleme. In den späten Jahren lebte Lilli Palmer überwiegend im Schweizer Goldingen und war als Autorin und Malerin tätig. Mehr zum Buch: die-preussische-diva.html
23. Mai 2014
Zuschauertäuschung im long con-Film
 „Ausgetrickst!“ ist die modifizierte Version einer Dissertation, die an der Universität Siegen entstanden ist. Es geht um Varianten des Trickbetrugs, um dessen filmische Darstellung in neueren amerikanischen Filmen – und es geht dabei natürlich vor allem um die Täuschung des Zuschauers, der durch eine geschickte Dramaturgie und eine entsprechende Erzählperspektive in die Irre geführt wird. Désirée Kriesch definiert zunächst sehr einleuchtend den long con, klärt wichtige Voraussetzungen für „Filmisches Erzählen“ und die „Irreführung als Gegenstand filmischen Erzählens“. Dafür reichen ihr rund 60 Seiten. Im Zentrum ihrer Analyse stehen vier Filme: THE STING (1973) von George Roy Hill mit Paul Newman und Robert Redford, CONFIDENCE (2003) von James Foley mit Edward Burns, MATCHSTICK MEN (2003) von Ridley Scott mit Nicolas Cage und THE SPANISH PRISONER (1997) von David Mamet mit Campbell Scott. Auf jeweils rund dreißig Seiten werden diese vier Filme dramaturgisch und visuell detailliert entschlüsselt. Das fördert viele interessante Beobachtungen und Erkenntnisse zutage, die sehr konkret und nachvollziehbar formuliert sind. In einem letzten Kapitel geht es um die Funktion des verdeckten long con, um die generische und historische Dimension und schließlich um die soziokulturelle Funktion. Der Anhang enthält eine umfangreiche Filmografie, eine Bibliografie und ein Glossar. Die Abbildungen sind hilfreich und technisch akzeptabel. Coverfoto: CONFIDENCE. Mehr zum Buch: www.wvttrier.de/ (dann das Buch suchen).
„Ausgetrickst!“ ist die modifizierte Version einer Dissertation, die an der Universität Siegen entstanden ist. Es geht um Varianten des Trickbetrugs, um dessen filmische Darstellung in neueren amerikanischen Filmen – und es geht dabei natürlich vor allem um die Täuschung des Zuschauers, der durch eine geschickte Dramaturgie und eine entsprechende Erzählperspektive in die Irre geführt wird. Désirée Kriesch definiert zunächst sehr einleuchtend den long con, klärt wichtige Voraussetzungen für „Filmisches Erzählen“ und die „Irreführung als Gegenstand filmischen Erzählens“. Dafür reichen ihr rund 60 Seiten. Im Zentrum ihrer Analyse stehen vier Filme: THE STING (1973) von George Roy Hill mit Paul Newman und Robert Redford, CONFIDENCE (2003) von James Foley mit Edward Burns, MATCHSTICK MEN (2003) von Ridley Scott mit Nicolas Cage und THE SPANISH PRISONER (1997) von David Mamet mit Campbell Scott. Auf jeweils rund dreißig Seiten werden diese vier Filme dramaturgisch und visuell detailliert entschlüsselt. Das fördert viele interessante Beobachtungen und Erkenntnisse zutage, die sehr konkret und nachvollziehbar formuliert sind. In einem letzten Kapitel geht es um die Funktion des verdeckten long con, um die generische und historische Dimension und schließlich um die soziokulturelle Funktion. Der Anhang enthält eine umfangreiche Filmografie, eine Bibliografie und ein Glossar. Die Abbildungen sind hilfreich und technisch akzeptabel. Coverfoto: CONFIDENCE. Mehr zum Buch: www.wvttrier.de/ (dann das Buch suchen).
22. Mai 2014
Takashi Miike
 Er ist der produktivste Regisseur des japanischen Gegenwartskinos. Über 90 Arbeiten hat er bisher realisiert, die sich zwischen Trash und Arthouse bewegen. Takashi Miike (* 1960) hat eine weltweite Fangemeinde, und die Film-Konzepte widmen ihm jetzt ihre Nr. 34, heraus-gegeben von Tanja Prokić. Neun Texte enthält die Publikation, es geht um Serialität und Singularität, um Genre, Tradition und interkulturelle Zusammenhänge, um Ästhetik und Gewalt, auch um Genderperspektiven. Die Herausgeberin Prokić und Alexander Schlicker analysieren den Film YATTERMAN und fragen nach der Darstellung des Superhelden. Arno Meteling beschäftigt sich mit Miikes Samuraifilmen 13 ASSASINS, HARA-KRI: DEATH OF A SAMURAI und IZO, zwei davon sind quasi Remakes. Alexander Schlicker stellt noch einmal 13 ASSASINS mit seinen ekstatischen Todesbildern ins Zentrum, während sich Elisabeth Scherer mit der monströsen Weiblichkeit in den Miike-Filmen auseinandersetzt. Marcus Stiglegger, von dem demnächst ein Kurosawa-Buch publiziert wird, schreibt über den Geschlechterkrieg in dem Psychothriller AUDITION. Den Musicalfilm THE HAPPINESS OF KATAKURIS bringt uns Kayo Adachi-Rabe näher. Bei Manuel Zahn geht es um das Anomale in VISITOR Q, bei Tanja Prokić um das Besondere des Films BIG BANG LOVE, JUVENILE A. Ivo Ritzer äußert sich schließlich zur Überschreitung medienkultureller Grenzen in der TV-Episode MASTERS OF HORROR: IMPRINT. Vielleicht wird Miike durch diese Publikation über den Kreis seiner Fans hinaus bekannt. Mehr zur Publikation: U3M7CxzdJgs
Er ist der produktivste Regisseur des japanischen Gegenwartskinos. Über 90 Arbeiten hat er bisher realisiert, die sich zwischen Trash und Arthouse bewegen. Takashi Miike (* 1960) hat eine weltweite Fangemeinde, und die Film-Konzepte widmen ihm jetzt ihre Nr. 34, heraus-gegeben von Tanja Prokić. Neun Texte enthält die Publikation, es geht um Serialität und Singularität, um Genre, Tradition und interkulturelle Zusammenhänge, um Ästhetik und Gewalt, auch um Genderperspektiven. Die Herausgeberin Prokić und Alexander Schlicker analysieren den Film YATTERMAN und fragen nach der Darstellung des Superhelden. Arno Meteling beschäftigt sich mit Miikes Samuraifilmen 13 ASSASINS, HARA-KRI: DEATH OF A SAMURAI und IZO, zwei davon sind quasi Remakes. Alexander Schlicker stellt noch einmal 13 ASSASINS mit seinen ekstatischen Todesbildern ins Zentrum, während sich Elisabeth Scherer mit der monströsen Weiblichkeit in den Miike-Filmen auseinandersetzt. Marcus Stiglegger, von dem demnächst ein Kurosawa-Buch publiziert wird, schreibt über den Geschlechterkrieg in dem Psychothriller AUDITION. Den Musicalfilm THE HAPPINESS OF KATAKURIS bringt uns Kayo Adachi-Rabe näher. Bei Manuel Zahn geht es um das Anomale in VISITOR Q, bei Tanja Prokić um das Besondere des Films BIG BANG LOVE, JUVENILE A. Ivo Ritzer äußert sich schließlich zur Überschreitung medienkultureller Grenzen in der TV-Episode MASTERS OF HORROR: IMPRINT. Vielleicht wird Miike durch diese Publikation über den Kreis seiner Fans hinaus bekannt. Mehr zur Publikation: U3M7CxzdJgs
21. Mai 2014
Drehbuchautoren auf der Leinwand
 Gar nicht so selten sind Drehbuch-autoren (und natürlich auch Autorinnen) – die sich gern als die großen Unbekannten im Film-geschäft bezeichnen – wichtige Figuren im Spielfilm. Mir fallen da sofort SUNSET BOULEVARD (1950) von Billy Wilder, IN A LONELY PLACE (1950) von Nicholas Ray, LE MÉPRIS (1963) von Jean-Luc Godard, THE LAST TYCOON (1976) von Elia Kazan, DER STAND DER DINGE (1982) von Wim Wenders oder THE PLAYER (1992) von Robert Altman ein. Dirk Hohnsträter hat das zum Thema eines kleinen, aber sehr originellen Buches gemacht, das nicht nur Autorinnen und Autoren gefallen müsste. Es gibt drei Kapitel und einen „Nachspann“. Zunächst geht es um die Figuren: wie werden die Drehbuchautoren im Spielfilm dargestellt? Hohnsträter hat 84 Filme gefunden, in denen sie eine wichtige Rolle spielen, meist befinden sie sich im Konflikt mit Produzent oder Regisseur, selten sind sie auf der Gewinnerseite. Es geht vor allem um Probleme mit der Anerkennung. Im zweiten Kapitel („Schreibszenen“) wird die Darstellung der Arbeit geschildert. Wo schreiben die Autoren? Welche Geräte benutzen sie? Das sind über Jahrzehnte natürlich vor allem Schreibmaschinen. Erst bei Wenders kommt der Computer ins Spiel. Im dritten Kapitel wird die Erzählweise thematisiert. Und im Nachspann protokolliert Hohnsträter die „vielleicht beste Einzelszene über das Drehbuchschreiben“, sie stammt aus dem Film THE LAST TYCOON und dauert 8:38 Minuten. Auch auf einige deutsche Filme geht der Autor genauer ein, zum Beispiel FRAUEN SIND KEINE ENGEL (1943) von Willi Forst mit Marte Harell als Autorin, FILM OHNE TITEL (1948) von Rudolf Jugert mit Fritz Odemar als Autor, SOLANGE DU DA BIST (1953) von Harald Braun mit Mathias Wieman als Autor, DIE ZÜRCHER VERLOBUNG (1957) von Helmut Käutner mit Liselotte Pulver als Autorin und das Remake von Stephan Meyer mit Lisa Martinek oder KOKOWÄÄH (2011) von Til Schweiger mit Schweiger als Autor. Es gibt eine Filmografie und eine Bibliografie. Nur der Titel des Büchleins ist, vorsichtig formuliert, etwas spröde. Mehr zum Buch: Autorschaft.html
Gar nicht so selten sind Drehbuch-autoren (und natürlich auch Autorinnen) – die sich gern als die großen Unbekannten im Film-geschäft bezeichnen – wichtige Figuren im Spielfilm. Mir fallen da sofort SUNSET BOULEVARD (1950) von Billy Wilder, IN A LONELY PLACE (1950) von Nicholas Ray, LE MÉPRIS (1963) von Jean-Luc Godard, THE LAST TYCOON (1976) von Elia Kazan, DER STAND DER DINGE (1982) von Wim Wenders oder THE PLAYER (1992) von Robert Altman ein. Dirk Hohnsträter hat das zum Thema eines kleinen, aber sehr originellen Buches gemacht, das nicht nur Autorinnen und Autoren gefallen müsste. Es gibt drei Kapitel und einen „Nachspann“. Zunächst geht es um die Figuren: wie werden die Drehbuchautoren im Spielfilm dargestellt? Hohnsträter hat 84 Filme gefunden, in denen sie eine wichtige Rolle spielen, meist befinden sie sich im Konflikt mit Produzent oder Regisseur, selten sind sie auf der Gewinnerseite. Es geht vor allem um Probleme mit der Anerkennung. Im zweiten Kapitel („Schreibszenen“) wird die Darstellung der Arbeit geschildert. Wo schreiben die Autoren? Welche Geräte benutzen sie? Das sind über Jahrzehnte natürlich vor allem Schreibmaschinen. Erst bei Wenders kommt der Computer ins Spiel. Im dritten Kapitel wird die Erzählweise thematisiert. Und im Nachspann protokolliert Hohnsträter die „vielleicht beste Einzelszene über das Drehbuchschreiben“, sie stammt aus dem Film THE LAST TYCOON und dauert 8:38 Minuten. Auch auf einige deutsche Filme geht der Autor genauer ein, zum Beispiel FRAUEN SIND KEINE ENGEL (1943) von Willi Forst mit Marte Harell als Autorin, FILM OHNE TITEL (1948) von Rudolf Jugert mit Fritz Odemar als Autor, SOLANGE DU DA BIST (1953) von Harald Braun mit Mathias Wieman als Autor, DIE ZÜRCHER VERLOBUNG (1957) von Helmut Käutner mit Liselotte Pulver als Autorin und das Remake von Stephan Meyer mit Lisa Martinek oder KOKOWÄÄH (2011) von Til Schweiger mit Schweiger als Autor. Es gibt eine Filmografie und eine Bibliografie. Nur der Titel des Büchleins ist, vorsichtig formuliert, etwas spröde. Mehr zum Buch: Autorschaft.html
19. Mai 2014
Große Filmprojekte – nicht realisiert
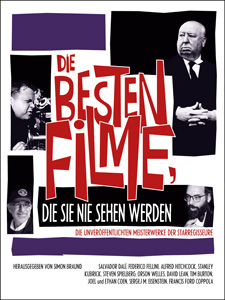 Es gab viele große Film-projekte, die nicht realisiert wurden: weil sie zu teuer wurden, weil die Regisseure nicht zu Potte kamen, weil andere schneller waren. Berühmt wurden zum Beispiel der nicht mehr realisierbare Marilyn Monroe-Film „Something’s Got to Give“ von George Cukor, das Napoleon-Projekt von Stanley Kubrick, der nicht aufgeführte „Holocaust“-Film von Jerry Lewis und das Leningrad-Projekt von Sergio Leone. 54 Projekte werden in diesem Buch von 15 internationalen Filmkritikern vorgestellt, die sie auch ausgewählt haben, beginnend mit einem Napoleon-Vorhaben von Charles Chaplin, endend mit dem Projekt „Potsdamer Platz“ von Tony Scott, der 2012 Suicid beging. Orson Welles hat wohl die meisten unvollendeten Projekte hinterlassen, aber es gab natürlich auch Pläne von Sergej Eisenstein, Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg oder den Coen Bros., die nicht verwirklicht wurden. „Brazzaville“ sollte die Fortsetzung von CASABLANCA werden, „La Genèse“ war ein visionäres Vorhaben von Robert Bresson und „Il viaggio di G. Mastorna“ wollte Federico Fellini mit Marcello Mastroianni drehen. Manchmal gab es schon Exposés oder Drehbücher, in einzelnen Fällen wurde bereits gedreht und dann abgebrochen, oft war die Werbekampagne längst im Gange und musste gestoppt werden. So gibt es bei vielen Projekten Informationen über den Stoff oder die geplante Besetzung. Simon Braund, Herausgeber des Buches, hat 48 fiktive Filmplakate entwerfen lassen, die man sich gut in der Kinorealität vorstellen kann. Zu jedem Text gehört die Information „Was danach geschah…“ und die Prognose einer noch möglichen Realisierung „Wie stehen die Chancen?“. In der Regel sind die Chancen gering. Bei manchen Projekten bedauert man das nicht, bei anderen ist man traurig. Ein originelles Buch mit vielen Abbildungen. Mehr zum Buch: index.php?id=281
Es gab viele große Film-projekte, die nicht realisiert wurden: weil sie zu teuer wurden, weil die Regisseure nicht zu Potte kamen, weil andere schneller waren. Berühmt wurden zum Beispiel der nicht mehr realisierbare Marilyn Monroe-Film „Something’s Got to Give“ von George Cukor, das Napoleon-Projekt von Stanley Kubrick, der nicht aufgeführte „Holocaust“-Film von Jerry Lewis und das Leningrad-Projekt von Sergio Leone. 54 Projekte werden in diesem Buch von 15 internationalen Filmkritikern vorgestellt, die sie auch ausgewählt haben, beginnend mit einem Napoleon-Vorhaben von Charles Chaplin, endend mit dem Projekt „Potsdamer Platz“ von Tony Scott, der 2012 Suicid beging. Orson Welles hat wohl die meisten unvollendeten Projekte hinterlassen, aber es gab natürlich auch Pläne von Sergej Eisenstein, Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg oder den Coen Bros., die nicht verwirklicht wurden. „Brazzaville“ sollte die Fortsetzung von CASABLANCA werden, „La Genèse“ war ein visionäres Vorhaben von Robert Bresson und „Il viaggio di G. Mastorna“ wollte Federico Fellini mit Marcello Mastroianni drehen. Manchmal gab es schon Exposés oder Drehbücher, in einzelnen Fällen wurde bereits gedreht und dann abgebrochen, oft war die Werbekampagne längst im Gange und musste gestoppt werden. So gibt es bei vielen Projekten Informationen über den Stoff oder die geplante Besetzung. Simon Braund, Herausgeber des Buches, hat 48 fiktive Filmplakate entwerfen lassen, die man sich gut in der Kinorealität vorstellen kann. Zu jedem Text gehört die Information „Was danach geschah…“ und die Prognose einer noch möglichen Realisierung „Wie stehen die Chancen?“. In der Regel sind die Chancen gering. Bei manchen Projekten bedauert man das nicht, bei anderen ist man traurig. Ein originelles Buch mit vielen Abbildungen. Mehr zum Buch: index.php?id=281