18. September 2015
Auf Reisen mit Peter Nau
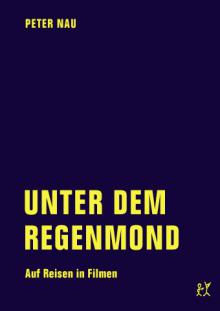 Das kleine Format der Bücher des Verbrecher Verlages ist ideal für seine Texte. Peter Nau schreibt in der Regel „Miniaturen“. Das sind Beobachtungen und Gedanken zu Filmen, die er gesehen hat. Vor zwei Jahren erschien der Band „Irgendwo in Berlin“ in der „Filit“-Reihe, die Rolf Aurich und Wolfgang Jacobsen herausgeben. Da ging es um Filme aus Deutschlands Westen und Osten. Jetzt gibt es die Sammlung „Unter dem Regenmond“. Zuerst erzählt Peter in 19 Miniaturen „Von fremden Ländern und Menschen“. Es sind fünf Filme dabei, sie ich sehr liebe: UGETSU MONOGATARI (1953) von Kenji Mizoguchi, WICHITA (1955) von Jacques Tourneur, CHARULATA (1964) von Satyajit Ray, EIN ABEITERCLUB IN SHEFFIELD (1965) von Peter Nestler, SCHATTENLAND (2005) von Volker Koepp und vier Filme, die ich sehr schätze: WIE YÜ GUNG BERGE VERSETZTE (1976) von Joris Ivens und Marcedline Loridan, ANNÄHERUNG. WALTER REUTER, FOTOGRAF UND FILMEMACHER IM EXIL (1991) von Lothar Schuster, AUS DER FERNE (2006) von Thomas Arslan und HOTEL SAHARA (2008) von Bettina Haasen. Die Filme werden mit den Texten sofort wieder präsent. Das zweite Kapitel heißt „Berlin um die Ecke“. Da erzählt Peter u.a. von einem Treffen mit dem Filmjournalisten Fred Gehler in Babelsberg, von Gehlers HEINRICH GEORGE-Porträt (1993), von Gerhard Lamprechts Film IRGENDWO IN BERLIN (1946), von einer spontanen Zusammenarbeit mit Harun Farocki und – ohne konkreten Filmbezug – von Ausflügen nach Weißensee, zu Schinkel-Bauwerken in Glienicke, in den Volkspark Rehberge, nach Plötzensee, von seinem Besuch bei einem Anästhesisten in Lichterfelde Ost und seinem Aufenthalt im Urban-Krankenhaus in Kreuzberg. Peters Texte werden beim Lesen immer zu Bildern, die sich schnell mit Geschichte verbinden. Im letzten Kapitel werden sieben Filme des Regisseurs Peter Goedel gewürdigt („Das unbekannte Meisterwerk“). Das Erscheinen dieses Buches wurde von der DEFA-Stiftung und der Stiftung Deutsche Kinemathek ermöglicht. Mehr zum Buch: book/detail/774
Das kleine Format der Bücher des Verbrecher Verlages ist ideal für seine Texte. Peter Nau schreibt in der Regel „Miniaturen“. Das sind Beobachtungen und Gedanken zu Filmen, die er gesehen hat. Vor zwei Jahren erschien der Band „Irgendwo in Berlin“ in der „Filit“-Reihe, die Rolf Aurich und Wolfgang Jacobsen herausgeben. Da ging es um Filme aus Deutschlands Westen und Osten. Jetzt gibt es die Sammlung „Unter dem Regenmond“. Zuerst erzählt Peter in 19 Miniaturen „Von fremden Ländern und Menschen“. Es sind fünf Filme dabei, sie ich sehr liebe: UGETSU MONOGATARI (1953) von Kenji Mizoguchi, WICHITA (1955) von Jacques Tourneur, CHARULATA (1964) von Satyajit Ray, EIN ABEITERCLUB IN SHEFFIELD (1965) von Peter Nestler, SCHATTENLAND (2005) von Volker Koepp und vier Filme, die ich sehr schätze: WIE YÜ GUNG BERGE VERSETZTE (1976) von Joris Ivens und Marcedline Loridan, ANNÄHERUNG. WALTER REUTER, FOTOGRAF UND FILMEMACHER IM EXIL (1991) von Lothar Schuster, AUS DER FERNE (2006) von Thomas Arslan und HOTEL SAHARA (2008) von Bettina Haasen. Die Filme werden mit den Texten sofort wieder präsent. Das zweite Kapitel heißt „Berlin um die Ecke“. Da erzählt Peter u.a. von einem Treffen mit dem Filmjournalisten Fred Gehler in Babelsberg, von Gehlers HEINRICH GEORGE-Porträt (1993), von Gerhard Lamprechts Film IRGENDWO IN BERLIN (1946), von einer spontanen Zusammenarbeit mit Harun Farocki und – ohne konkreten Filmbezug – von Ausflügen nach Weißensee, zu Schinkel-Bauwerken in Glienicke, in den Volkspark Rehberge, nach Plötzensee, von seinem Besuch bei einem Anästhesisten in Lichterfelde Ost und seinem Aufenthalt im Urban-Krankenhaus in Kreuzberg. Peters Texte werden beim Lesen immer zu Bildern, die sich schnell mit Geschichte verbinden. Im letzten Kapitel werden sieben Filme des Regisseurs Peter Goedel gewürdigt („Das unbekannte Meisterwerk“). Das Erscheinen dieses Buches wurde von der DEFA-Stiftung und der Stiftung Deutsche Kinemathek ermöglicht. Mehr zum Buch: book/detail/774
17. September 2015
Architektur im Film
 Das Buch basiert auf einer Tagung, die 2012 an der Katholisch-Theologischen Privatuniversität Linz stattgefunden hat. Sieben überarbeitete Vorträge und zwei zusätzliche Texte (von Jeanpaul Goergen und Rolf Sachsse) sind hier ver-sammelt. Sie bauen interessante Brücken zwischen Architektur-geschichte und Film. Helmut Weihsmann beschreibt in seinem Beitrag „Cinetectur – Architektur im Zeitalter des Films“ die Interaktion von Film und Architektur. Rolf Sachsse reflektiert unter dem Titel „Türme von Notre Dame: Werdet Bild!“ über die technischen Medien und ihr Bild der Architektur-geschichte. Christiane Keim analysiert den Lehrfilm DIE FRANKFURTER KÜCHE (1928) als mediale Repräsentation des „Neuen Frankfurt“ in den 1920er Jahren. Lena Christolova widmet sich in ihrem Beitrag den Vorgaben des Kunsthistorikers Heinrich Wölfflin und des Architekten Le Corbusier und konfrontiert sie mit den Raum-Darstellungen in Godard LE MÉPRIS. Jeanpaul Goergen hat acht Filme aus den 1950er Jahren gefunden, die für den Wiederaufbau in der Bundesrepublik werben, aber nicht interessiert waren an der Meinung der beteiligten Bürgerinnen und Bürger. Lutz Robbers referiert generalisierend über „Architekturgeschichte im Zeitalter des Films“. Bei Barbara Schrödl geht es um den Kunsthistoriker und Filmemacher Carl Lamb und seinen Film RAUM IM KREISENDEN LICHT (1936). Doris Agotai und Marcel Bächtiger formulieren Manifeste für einen Architekturfilm. Und Christina Threuter analysiert den Architekturfilm LOOS ORNAMENTAL (2006) von Heinz Emigholz. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: architektur-im-film?c=738
Das Buch basiert auf einer Tagung, die 2012 an der Katholisch-Theologischen Privatuniversität Linz stattgefunden hat. Sieben überarbeitete Vorträge und zwei zusätzliche Texte (von Jeanpaul Goergen und Rolf Sachsse) sind hier ver-sammelt. Sie bauen interessante Brücken zwischen Architektur-geschichte und Film. Helmut Weihsmann beschreibt in seinem Beitrag „Cinetectur – Architektur im Zeitalter des Films“ die Interaktion von Film und Architektur. Rolf Sachsse reflektiert unter dem Titel „Türme von Notre Dame: Werdet Bild!“ über die technischen Medien und ihr Bild der Architektur-geschichte. Christiane Keim analysiert den Lehrfilm DIE FRANKFURTER KÜCHE (1928) als mediale Repräsentation des „Neuen Frankfurt“ in den 1920er Jahren. Lena Christolova widmet sich in ihrem Beitrag den Vorgaben des Kunsthistorikers Heinrich Wölfflin und des Architekten Le Corbusier und konfrontiert sie mit den Raum-Darstellungen in Godard LE MÉPRIS. Jeanpaul Goergen hat acht Filme aus den 1950er Jahren gefunden, die für den Wiederaufbau in der Bundesrepublik werben, aber nicht interessiert waren an der Meinung der beteiligten Bürgerinnen und Bürger. Lutz Robbers referiert generalisierend über „Architekturgeschichte im Zeitalter des Films“. Bei Barbara Schrödl geht es um den Kunsthistoriker und Filmemacher Carl Lamb und seinen Film RAUM IM KREISENDEN LICHT (1936). Doris Agotai und Marcel Bächtiger formulieren Manifeste für einen Architekturfilm. Und Christina Threuter analysiert den Architekturfilm LOOS ORNAMENTAL (2006) von Heinz Emigholz. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: architektur-im-film?c=738
16. September 2015
Architektur und Medien
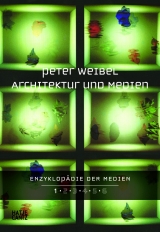 Peter Weibel (*1944) gilt als eine zentrale Figur der europäischen Medienkunst. Er ist seit 1984 Professor für Mediengestaltung und -theorie an der Universität für angewandte Kunst in Wien und seit 1999 Vorstand des ZKM/Zentrum für Kunst und Medien-technologie Karlsruhe. Seine Präsenz bei Tagungen und Ausstellungen gilt als konkurrenzlos, entsprechend groß ist sie in den einschlägigen Publikationen. Erstmals wird jetzt der Versuch unternommen, in einer sechsbändigen Schriftenreihe („Enzyklopädie der Medien“) seine Texte, die oft im Verborgenen erscheinen, zugänglich zu machen. Hatje Cantz hat sich als Verlag dafür angeboten. Der erste Band handelt von „Architektur und Medien“. 28 Texte sind hier versammelt, beginnend mit dem Vortrag „Territorium und Technik“ (1988/98), endend mit dem Katalogtext „Jenseits der Erde / Das orbitale Zeitalter“ (1986). Die Beiträge sind nicht chronologisch geordnet, ihre Reihenfolge wird nicht erklärt. Ein Index erschließt den Textkorpus. Schlüsseltexte sind für mich „Vom Verschwinden der Ferne. Die Trennung von Bote und Botschaft“ (1990, zu einer Ausstellung des Deutschen Postmuseums in Frankfurt am Main), „Der Pavillon der Medien von Coop Himmel(b)lau. Eine neue Gleichung zwischen Kunst und Architektur“ (1995, zur Biennale di Venezia; Weibel war in jenem Jahr ‚Kommissär’ des Österreichischen Pavillons), „Schaufenster-Botschaften. Ein Piktorial zur Ikonografie des Urbanismus“ (1979, zu einer Ausstellung des Steirischen Herbstes) und „Architektur Algorithmen“ (1996, über das Programm von Manfred Wolff-Plottegg). Natürlich hat mir auch der Text über die „Infobox“ von Schneider + Schumacher am Potsdamer Platz gefallen, die ich oft besucht habe. Der jüngste Beitrag, „Architektur und Information“ (2014), betrifft den Newsroom von Veech x Veech Design in London. Der zweite Band handelt von „Musik und Medien“. Mehr zum Buch: 1-6227-0.html
Peter Weibel (*1944) gilt als eine zentrale Figur der europäischen Medienkunst. Er ist seit 1984 Professor für Mediengestaltung und -theorie an der Universität für angewandte Kunst in Wien und seit 1999 Vorstand des ZKM/Zentrum für Kunst und Medien-technologie Karlsruhe. Seine Präsenz bei Tagungen und Ausstellungen gilt als konkurrenzlos, entsprechend groß ist sie in den einschlägigen Publikationen. Erstmals wird jetzt der Versuch unternommen, in einer sechsbändigen Schriftenreihe („Enzyklopädie der Medien“) seine Texte, die oft im Verborgenen erscheinen, zugänglich zu machen. Hatje Cantz hat sich als Verlag dafür angeboten. Der erste Band handelt von „Architektur und Medien“. 28 Texte sind hier versammelt, beginnend mit dem Vortrag „Territorium und Technik“ (1988/98), endend mit dem Katalogtext „Jenseits der Erde / Das orbitale Zeitalter“ (1986). Die Beiträge sind nicht chronologisch geordnet, ihre Reihenfolge wird nicht erklärt. Ein Index erschließt den Textkorpus. Schlüsseltexte sind für mich „Vom Verschwinden der Ferne. Die Trennung von Bote und Botschaft“ (1990, zu einer Ausstellung des Deutschen Postmuseums in Frankfurt am Main), „Der Pavillon der Medien von Coop Himmel(b)lau. Eine neue Gleichung zwischen Kunst und Architektur“ (1995, zur Biennale di Venezia; Weibel war in jenem Jahr ‚Kommissär’ des Österreichischen Pavillons), „Schaufenster-Botschaften. Ein Piktorial zur Ikonografie des Urbanismus“ (1979, zu einer Ausstellung des Steirischen Herbstes) und „Architektur Algorithmen“ (1996, über das Programm von Manfred Wolff-Plottegg). Natürlich hat mir auch der Text über die „Infobox“ von Schneider + Schumacher am Potsdamer Platz gefallen, die ich oft besucht habe. Der jüngste Beitrag, „Architektur und Information“ (2014), betrifft den Newsroom von Veech x Veech Design in London. Der zweite Band handelt von „Musik und Medien“. Mehr zum Buch: 1-6227-0.html
15. September 2015
Stanley Kubricks 2001
 Vor fünfzig Jahren hat Stanley Kubrick seinen Film 2001: A SPACE ODYSSEY gedreht. Ein halbes Jahr dauerten die Aufnahmen in den Londoner Studios, für die Special Effects brauchte der Regisseur weitere achtzehn Monate. Der Film wurde in 70mm realisiert, er kostete damals mehr als zehn Millionen $, kam mit 16 Monaten Verspätung ins Kino und wurde in der westlichen Welt ein großer Erfolg. In Berlin, daran erinnere ich mich, musste man über zwei Jahre auf ihn warten, weil der Royal-Palast von dem Mega-Hit DOCTOR ZHIVAGO besetzt war. Ein alternatives Kino gab es nicht. Wer ungeduldig war, fuhr nach München, Hamburg oder in eine andere Stadt. Kubricks Film ist inzwischen ein Mythos. Im Taschen Verlag wurde jetzt das Buch „The Making of Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey“ von Piers Bizony publiziert, das sich als wahre Schatzkammer erweist. Umfang: 562 Seiten. Format: 18 cm breit, 38 cm hoch. Neun Teile strukturieren das Buch: I. „Journey Beyond the Stars“ (das war der Arbeitstitel des Projekts; der Autor erzählt kurz Kubricks Biografie und ausführlich von der Zusammenarbeit mit dem Autor Arthur C. Clarke, dessen Story „The Sentinel“ der Ausgangspunkt für 2001 war). II. „A King of Infinitive Space“ (über die Konzeptionierung des Raumschiffs Discovery). III. Santa’s Workshop (über die Postproduction). IV. („The Dawn of Man“ (über den Beginn des Films mit dem Kampf zweier Affengruppen und das Auftauchen eines Monolithen). V. „Stanley on Set“ (über Kubricks Arbeit mit den Darstellern). „They Hated It, They Loved It“ (über die Reaktionen der Kritik, mit einem Kubrick-Interview von Joseph Gelmis). VII. „Yesterday’s Tomorrow“ (über den Film 2001 aus heutiger Perspektive). VIII. „Are We Alone?“ (über den Astronomen Frank Drake und die Möglichkeiten eines extraterrestrischen Lebens ). IX. „Film Synopsis“ (eine ausführliche Inhaltsangabe). Die Texte sind kenntnisreich und lesenswert. Überwältigend ist das Bilderangebot. Immer wieder gibt es ausklappbare Seiten, die das Format verdoppeln. Die technische Qualität ist hervorragend. Kleine Bilder in der Marginalspalte der Texte verweisen bereits auf die großen Bilder. Der Autor hatte natürlich Zugang zum Stanley Kubrick Archiv. Dort kann man – wie die Leserinnen und Leser – über dieses Buch glücklich sein. Mehr zum Buch: 2001_a_space_odyssey.htm
Vor fünfzig Jahren hat Stanley Kubrick seinen Film 2001: A SPACE ODYSSEY gedreht. Ein halbes Jahr dauerten die Aufnahmen in den Londoner Studios, für die Special Effects brauchte der Regisseur weitere achtzehn Monate. Der Film wurde in 70mm realisiert, er kostete damals mehr als zehn Millionen $, kam mit 16 Monaten Verspätung ins Kino und wurde in der westlichen Welt ein großer Erfolg. In Berlin, daran erinnere ich mich, musste man über zwei Jahre auf ihn warten, weil der Royal-Palast von dem Mega-Hit DOCTOR ZHIVAGO besetzt war. Ein alternatives Kino gab es nicht. Wer ungeduldig war, fuhr nach München, Hamburg oder in eine andere Stadt. Kubricks Film ist inzwischen ein Mythos. Im Taschen Verlag wurde jetzt das Buch „The Making of Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey“ von Piers Bizony publiziert, das sich als wahre Schatzkammer erweist. Umfang: 562 Seiten. Format: 18 cm breit, 38 cm hoch. Neun Teile strukturieren das Buch: I. „Journey Beyond the Stars“ (das war der Arbeitstitel des Projekts; der Autor erzählt kurz Kubricks Biografie und ausführlich von der Zusammenarbeit mit dem Autor Arthur C. Clarke, dessen Story „The Sentinel“ der Ausgangspunkt für 2001 war). II. „A King of Infinitive Space“ (über die Konzeptionierung des Raumschiffs Discovery). III. Santa’s Workshop (über die Postproduction). IV. („The Dawn of Man“ (über den Beginn des Films mit dem Kampf zweier Affengruppen und das Auftauchen eines Monolithen). V. „Stanley on Set“ (über Kubricks Arbeit mit den Darstellern). „They Hated It, They Loved It“ (über die Reaktionen der Kritik, mit einem Kubrick-Interview von Joseph Gelmis). VII. „Yesterday’s Tomorrow“ (über den Film 2001 aus heutiger Perspektive). VIII. „Are We Alone?“ (über den Astronomen Frank Drake und die Möglichkeiten eines extraterrestrischen Lebens ). IX. „Film Synopsis“ (eine ausführliche Inhaltsangabe). Die Texte sind kenntnisreich und lesenswert. Überwältigend ist das Bilderangebot. Immer wieder gibt es ausklappbare Seiten, die das Format verdoppeln. Die technische Qualität ist hervorragend. Kleine Bilder in der Marginalspalte der Texte verweisen bereits auf die großen Bilder. Der Autor hatte natürlich Zugang zum Stanley Kubrick Archiv. Dort kann man – wie die Leserinnen und Leser – über dieses Buch glücklich sein. Mehr zum Buch: 2001_a_space_odyssey.htm
14. September 2015
Memorials
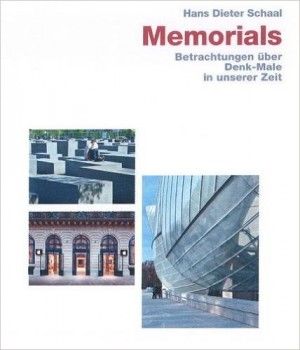 Hans Dieter Schaal hat vor zwanzig Jahren die Aus-stellung „Kino * Movie * Cinéma“ im Martin-Gropius-Bau gestaltet und fünf Jahre danach die Ständige Ausstel-lung des Film-museums Berlin. Die Zusammenarbeit mit ihm war wunderbar, ich habe sehr viel von ihm gelernt. Bei der Lektüre seines jüngst erschienenen Buches „Memorials – Betrachtungen über Denk-Male in unserer Zeit“ wurde mir wieder klar, wie reflektiert sein Blick auf die Geschichte ist. Es geht um die Erinnerung und wie sie sich im 20. Jahrhundert und im gerade begonnenen 21. verändert hat. Die Medien – zuerst das Kino, dann das Fernsehen und inzwischen das Internet – sorgen für eine Präsenz der Geschichte. In zwölf Kapiteln wird das von Schaal konkretisiert. Er beginnt mit einem Rückblick auf den ersten Medienwechsel, die Fernsehrevolution. Es folgt der zweite Medienwechsel mit Gedanken zu den zukünftigen Denkmälern der Computer- und Internetrevolution. Im Zentrum steht das Kapitel über „Neue Museen“, in dem u.a. das Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou in Paris, das Museumsufer in Frankfurt am Main, das Museum of Modern Art in New York, das Deutsche Historische Museum in Berlin, das Deutsche Museum in München, das Guggenheim Bilbao Museoa, das Phaeno Science Center in Wolfsburg, das MAXXI-Museo nazionale delle Arti del XXI secolo in Rom, die BMW Welt in München und das Auditorio de Tenerife in Santa Cruz von Schaal sehr persönlich beschrieben und konzeptionell eingeschätzt werden. Ein eigenes Kapitel ist den Vergnügungsparks von Walt Disney gewidmet. Dann geht es um Denkmäler des Konsums, um Autos als Denkmäler und „Denkmalsersatzobjekte“ (mit einem Verweis auf die Filmgeschichte), um Denkmäler der Landschaftszerstörung, um Erinnerungen an das Atomzeitalter und den 11. September und schließlich um Denkmäler des kosmischen Fernwehs. Den Abschluss bildet ein Kapitel über Friedhöfe. Schaal hat eine große Fähigkeit, uns mit all diesen Schauplätze in ihrer Bedeutung und, in manchen Fällen, auch in ihrer Trivialität zu konfrontieren. Die zahlreichen Abbildungen sind hilfreich. Ich bin beeindruckt. Mehr zum Buch: Schaal_Memorials.pdf
Hans Dieter Schaal hat vor zwanzig Jahren die Aus-stellung „Kino * Movie * Cinéma“ im Martin-Gropius-Bau gestaltet und fünf Jahre danach die Ständige Ausstel-lung des Film-museums Berlin. Die Zusammenarbeit mit ihm war wunderbar, ich habe sehr viel von ihm gelernt. Bei der Lektüre seines jüngst erschienenen Buches „Memorials – Betrachtungen über Denk-Male in unserer Zeit“ wurde mir wieder klar, wie reflektiert sein Blick auf die Geschichte ist. Es geht um die Erinnerung und wie sie sich im 20. Jahrhundert und im gerade begonnenen 21. verändert hat. Die Medien – zuerst das Kino, dann das Fernsehen und inzwischen das Internet – sorgen für eine Präsenz der Geschichte. In zwölf Kapiteln wird das von Schaal konkretisiert. Er beginnt mit einem Rückblick auf den ersten Medienwechsel, die Fernsehrevolution. Es folgt der zweite Medienwechsel mit Gedanken zu den zukünftigen Denkmälern der Computer- und Internetrevolution. Im Zentrum steht das Kapitel über „Neue Museen“, in dem u.a. das Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou in Paris, das Museumsufer in Frankfurt am Main, das Museum of Modern Art in New York, das Deutsche Historische Museum in Berlin, das Deutsche Museum in München, das Guggenheim Bilbao Museoa, das Phaeno Science Center in Wolfsburg, das MAXXI-Museo nazionale delle Arti del XXI secolo in Rom, die BMW Welt in München und das Auditorio de Tenerife in Santa Cruz von Schaal sehr persönlich beschrieben und konzeptionell eingeschätzt werden. Ein eigenes Kapitel ist den Vergnügungsparks von Walt Disney gewidmet. Dann geht es um Denkmäler des Konsums, um Autos als Denkmäler und „Denkmalsersatzobjekte“ (mit einem Verweis auf die Filmgeschichte), um Denkmäler der Landschaftszerstörung, um Erinnerungen an das Atomzeitalter und den 11. September und schließlich um Denkmäler des kosmischen Fernwehs. Den Abschluss bildet ein Kapitel über Friedhöfe. Schaal hat eine große Fähigkeit, uns mit all diesen Schauplätze in ihrer Bedeutung und, in manchen Fällen, auch in ihrer Trivialität zu konfrontieren. Die zahlreichen Abbildungen sind hilfreich. Ich bin beeindruckt. Mehr zum Buch: Schaal_Memorials.pdf
13. September 2015
BLACKOUT – ANATOMIE EINER LEIDENSCHAFT (1979)
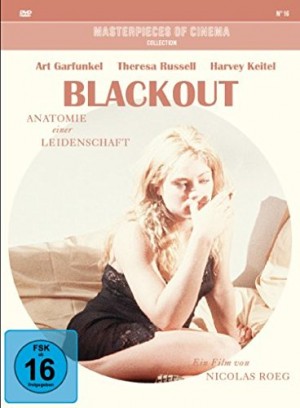 Wenn zwei so unter-schiedliche Menschen aufeinander treffen wie die spontane, unbe-rechenbare Amerikanerin Milena Flaherty und der kühle, scheinbar stabile Psychoanalytiker Alex Linden, dann kann es schnell um Leben und Tod gehen. Milena wird zu Beginn des Films im Koma ins Krankenhaus gebracht und dort – wie wir am Ende erfahren – erfolgreich operiert. Alex hat den Krankenwagen angefordert. Was zuvor geschah, wird in einem langen Verhör durch den ermittelnden Inspektor Netusil aufgeklärt. Eine gewisse Rolle spielt auch noch der Ehemann von Milena, der in Bratislava wohnt. Hauptschauplatz des Films ist Wien in den 1970er Jahren. Die Stadt wird beeindruckend ins spannende Spiel einbezogen. Nicolas Roeg experimentiert gern mit Hilfe der Montage. Zeiten und Orte wechseln in großer Geschwindigkeit. BAD TIMING ist der Originaltitel des Films. In der Tat passiert hier vieles zur falschen Zeit. Und immer wieder wird der Operationssaal mit der um ihr Leben kämpfenden Milena in die Abläufe eingeschnitten. Drei Darsteller dominieren den Film: Art Garfunkel als Alex Linden, Theresa Russell als Milena Flaherty und Harvey Keitel als Inspektor Netusil, der vor allem in der zweiten Hälfte die Führungsrolle übernimmt. Ein spannender Film mit vielen schockierenden Momenten. Bei Koch Media ist jetzt in der Reihe „Masterpieces of Cinema“ die DVD des Films erschienen. Der sehr kluge Text im Booklet stammt von Christoph Huber. Mehr zur DVD: masterpieces_of_cinema_dvd/
Wenn zwei so unter-schiedliche Menschen aufeinander treffen wie die spontane, unbe-rechenbare Amerikanerin Milena Flaherty und der kühle, scheinbar stabile Psychoanalytiker Alex Linden, dann kann es schnell um Leben und Tod gehen. Milena wird zu Beginn des Films im Koma ins Krankenhaus gebracht und dort – wie wir am Ende erfahren – erfolgreich operiert. Alex hat den Krankenwagen angefordert. Was zuvor geschah, wird in einem langen Verhör durch den ermittelnden Inspektor Netusil aufgeklärt. Eine gewisse Rolle spielt auch noch der Ehemann von Milena, der in Bratislava wohnt. Hauptschauplatz des Films ist Wien in den 1970er Jahren. Die Stadt wird beeindruckend ins spannende Spiel einbezogen. Nicolas Roeg experimentiert gern mit Hilfe der Montage. Zeiten und Orte wechseln in großer Geschwindigkeit. BAD TIMING ist der Originaltitel des Films. In der Tat passiert hier vieles zur falschen Zeit. Und immer wieder wird der Operationssaal mit der um ihr Leben kämpfenden Milena in die Abläufe eingeschnitten. Drei Darsteller dominieren den Film: Art Garfunkel als Alex Linden, Theresa Russell als Milena Flaherty und Harvey Keitel als Inspektor Netusil, der vor allem in der zweiten Hälfte die Führungsrolle übernimmt. Ein spannender Film mit vielen schockierenden Momenten. Bei Koch Media ist jetzt in der Reihe „Masterpieces of Cinema“ die DVD des Films erschienen. Der sehr kluge Text im Booklet stammt von Christoph Huber. Mehr zur DVD: masterpieces_of_cinema_dvd/
12. September 2015
Gefangen in der Kinohöhle
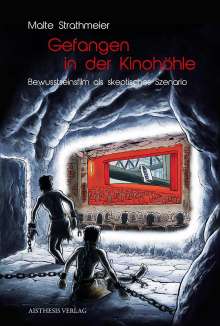 Eine Dissertation aus Biele-feld. Malte Strathmeier reflektiert in seiner inter-disziplinären Untersuchung die Stärken des Kinos, das die Zuschauer wie Platons Höhle betreten und in dem sie nicht nur unterhalten werden, sondern viele neue Erkenntnisse gewinnen können. Der Autor geht bei seinen interessanten Thesen von einem „Skeptischen Szenario“ aus. Das ist für ihn: „Eine angenommene Situation (ein bedenklicher Entwurf), die eine skeptische Hypothese (Ich kann nicht wissen, ob ich gerade träume) ausbuchstabiert. In einem skeptischen Szenario mit starken Kriterien wird eine Person derart über das Wesen der Welt getäuscht, dass sie keinerlei Möglichkeit hat, zu erkennen, was wahr ist und was nicht. Sie wird also allumfassend getäuscht, hat die gleichen Wahrnehmungserfahrungen wie jetzt und kann zwischen diesen nicht unterscheiden. Ihre Überzeugungen sind alle falsch. In einem skeptischen Szenario mit schwachen Kriterien kann die Person die Täuschung durchschauen und dadurch über ihre epistemische Situation Wissen erlangen.“ (Glossar, S. 245). Als Filmbeispiele dienen vor allem amerikanische Filme: eXistenZ (1999) von David Cronenberg, THE SIXTH SENSE (1999) von M. Night Shyamaian, THE MATRIX (1999) von den Wachowiak Geschwistern, VANILLA SKY (2001) von Cameron Crowe, IDENTITY (2003) von James Mangold und natürlich INCEPTION (2010) von Christopher Nolan. Die Publikation unternimmt einen gedanklichen Drahtseilakt zwischen Film und Philosophie. 24 Abbildungen in guter Qualität. Cover: „Kinohöhle“ von Ralf Schlüter. Mehr zum Buch: www.aisthesis.de/ (dort nach dem Titel suchen).
Eine Dissertation aus Biele-feld. Malte Strathmeier reflektiert in seiner inter-disziplinären Untersuchung die Stärken des Kinos, das die Zuschauer wie Platons Höhle betreten und in dem sie nicht nur unterhalten werden, sondern viele neue Erkenntnisse gewinnen können. Der Autor geht bei seinen interessanten Thesen von einem „Skeptischen Szenario“ aus. Das ist für ihn: „Eine angenommene Situation (ein bedenklicher Entwurf), die eine skeptische Hypothese (Ich kann nicht wissen, ob ich gerade träume) ausbuchstabiert. In einem skeptischen Szenario mit starken Kriterien wird eine Person derart über das Wesen der Welt getäuscht, dass sie keinerlei Möglichkeit hat, zu erkennen, was wahr ist und was nicht. Sie wird also allumfassend getäuscht, hat die gleichen Wahrnehmungserfahrungen wie jetzt und kann zwischen diesen nicht unterscheiden. Ihre Überzeugungen sind alle falsch. In einem skeptischen Szenario mit schwachen Kriterien kann die Person die Täuschung durchschauen und dadurch über ihre epistemische Situation Wissen erlangen.“ (Glossar, S. 245). Als Filmbeispiele dienen vor allem amerikanische Filme: eXistenZ (1999) von David Cronenberg, THE SIXTH SENSE (1999) von M. Night Shyamaian, THE MATRIX (1999) von den Wachowiak Geschwistern, VANILLA SKY (2001) von Cameron Crowe, IDENTITY (2003) von James Mangold und natürlich INCEPTION (2010) von Christopher Nolan. Die Publikation unternimmt einen gedanklichen Drahtseilakt zwischen Film und Philosophie. 24 Abbildungen in guter Qualität. Cover: „Kinohöhle“ von Ralf Schlüter. Mehr zum Buch: www.aisthesis.de/ (dort nach dem Titel suchen).
11. September 2015
Internet-Blog zum Filmerbe
 Seit 1. September steht der Internet-Blog www.kinematheken.info im Netz, der von dem Filmemacher Helmut Herbst und dem Film-kritiker Daniel Kothenschulte verantwortet wird. Er widmet sich allen Fragen, die mit dem Erhalt des Filmerbes verbunden sind. Herbst und Kothenschulte sind frei von institutionellen Bindungen und Interessen, sie handeln und schreiben aus einem persönlichen Engagement. Sie haben eine kritische Position zu den bisher bekannt gewordenen Plänen der deutschen Kulturpolitik, wie sie in den letzten Monaten in zahlreichen Interviews und Statements verlautbart worden sind. Das wird deutlich im „Vorspann“ von Helmut Herbst, in seiner Stellungnahme zu einem PWC-Gutachten zur „Kostenabschätzung zur digitalen Sicherung des Filmischen Erbes“ im Auftrag der FFA (mit einer Replik von Rainer Rother), in dem Text „Ausgrabungsstätten für die Zukunft“ von Daniel Kothenschulte, in den Hinweisen „Zur Kassationspraxis“ von Dirk Alt. Provokant wirkt ein kurzer Film mit brennendem Nitromaterial unter dem Titel „FIAF Code of Ethics“ und der einkopierten Frage „Was wird aus unserem Filmerbe?“. Das alles ist auf der Website unter der Rubrik „Positionen“ zu finden. Hilfreich sind die Erklärungen im „Glossar“ zu Begriffen wie Archivfeste Speichermedien, Blu-ray (BD), DCP, Duplikatfilme, easyDCP, Essig-Syndrom, Farbauszüge (YCM/RGB), FIAF – Code of Ethics, Film-Scanner, HDTV, Klima-Bedingungen für die Film-Archivierung, Langzeitsicherung, LTO, Nitro-Filme, Obsolenz und digitale Medien, Umkopierung von Nitrofilmen und deren Kassation, Vinegar-Syndrome. Dass die Seite schön gestaltet ist, wird viele User besonders erfreuen. Über den Namen der Website wird der Deutsche Kinematheksverbund nicht glücklich sein. Aber er war frei.
Seit 1. September steht der Internet-Blog www.kinematheken.info im Netz, der von dem Filmemacher Helmut Herbst und dem Film-kritiker Daniel Kothenschulte verantwortet wird. Er widmet sich allen Fragen, die mit dem Erhalt des Filmerbes verbunden sind. Herbst und Kothenschulte sind frei von institutionellen Bindungen und Interessen, sie handeln und schreiben aus einem persönlichen Engagement. Sie haben eine kritische Position zu den bisher bekannt gewordenen Plänen der deutschen Kulturpolitik, wie sie in den letzten Monaten in zahlreichen Interviews und Statements verlautbart worden sind. Das wird deutlich im „Vorspann“ von Helmut Herbst, in seiner Stellungnahme zu einem PWC-Gutachten zur „Kostenabschätzung zur digitalen Sicherung des Filmischen Erbes“ im Auftrag der FFA (mit einer Replik von Rainer Rother), in dem Text „Ausgrabungsstätten für die Zukunft“ von Daniel Kothenschulte, in den Hinweisen „Zur Kassationspraxis“ von Dirk Alt. Provokant wirkt ein kurzer Film mit brennendem Nitromaterial unter dem Titel „FIAF Code of Ethics“ und der einkopierten Frage „Was wird aus unserem Filmerbe?“. Das alles ist auf der Website unter der Rubrik „Positionen“ zu finden. Hilfreich sind die Erklärungen im „Glossar“ zu Begriffen wie Archivfeste Speichermedien, Blu-ray (BD), DCP, Duplikatfilme, easyDCP, Essig-Syndrom, Farbauszüge (YCM/RGB), FIAF – Code of Ethics, Film-Scanner, HDTV, Klima-Bedingungen für die Film-Archivierung, Langzeitsicherung, LTO, Nitro-Filme, Obsolenz und digitale Medien, Umkopierung von Nitrofilmen und deren Kassation, Vinegar-Syndrome. Dass die Seite schön gestaltet ist, wird viele User besonders erfreuen. Über den Namen der Website wird der Deutsche Kinematheksverbund nicht glücklich sein. Aber er war frei.
10. September 2015
Tim Burton
 Im Max Ernst Museum Brühl ist seit Mitte August (und noch bis zum 3. Januar 2016) die Ausstellung „The World of Tim Burton“ zu sehen. Sie ermöglicht einen Blick in seine Werkstatt mit vielen Entwürfen, die in seinen Filmen oft ganz anders gestaltet wurden, mit Zeichnungen, Gemälden, Fotografien, Skulpturen, Puppen und bewegten Bildern. Der Katalog zur Ausstellung ist bei Hatje Canz erschienen. Die Texte sind zweisprachig (deutsch und englisch), die Abbildungen faszinieren durch ihre fantastischen Ideen. Zu lesen sind ein Geleitwort vom Vorsitzenden des Vorstandes der Stiftung Max Ernst, Jürgen Wilhelm, ein Vorwort vom Direktor des Max Ernst Museums, Achim Sommer, eine Einführung in die Ausstellung von der Kuratorin Jenny He, ein kurzes, sehr persönliches Statement von Tim Burton, ein Gespräch mit ihm, das Achim Sommer und Patrick Blümel geführt haben, und eine Biografie, die Patrick Blümel zusammengestellt hat. Zu sehen sind ausgewählte Werke in hervorragender Reproduktion, die uns in der Tat „die Welt“ von Tim Burton vor Augen führen. Ich schätze seine Filme sehr, vor allem EDWARD SCISSORHANDS, MARS ATTACKS!, BIG FISH und ALICE IN WONDERLAND. Wenn ich es schaffe, werde ich mir die Ausstellung in Brühl noch anschauen. Felicitas Kleiner hat in der letzten Nummer des Film-Dienstes eine schöne Rezension geschrieben. Mehr zur Ausstellung: the_world_of_tim_burton.html . Mehr zum Buch: 6536-0.html
Im Max Ernst Museum Brühl ist seit Mitte August (und noch bis zum 3. Januar 2016) die Ausstellung „The World of Tim Burton“ zu sehen. Sie ermöglicht einen Blick in seine Werkstatt mit vielen Entwürfen, die in seinen Filmen oft ganz anders gestaltet wurden, mit Zeichnungen, Gemälden, Fotografien, Skulpturen, Puppen und bewegten Bildern. Der Katalog zur Ausstellung ist bei Hatje Canz erschienen. Die Texte sind zweisprachig (deutsch und englisch), die Abbildungen faszinieren durch ihre fantastischen Ideen. Zu lesen sind ein Geleitwort vom Vorsitzenden des Vorstandes der Stiftung Max Ernst, Jürgen Wilhelm, ein Vorwort vom Direktor des Max Ernst Museums, Achim Sommer, eine Einführung in die Ausstellung von der Kuratorin Jenny He, ein kurzes, sehr persönliches Statement von Tim Burton, ein Gespräch mit ihm, das Achim Sommer und Patrick Blümel geführt haben, und eine Biografie, die Patrick Blümel zusammengestellt hat. Zu sehen sind ausgewählte Werke in hervorragender Reproduktion, die uns in der Tat „die Welt“ von Tim Burton vor Augen führen. Ich schätze seine Filme sehr, vor allem EDWARD SCISSORHANDS, MARS ATTACKS!, BIG FISH und ALICE IN WONDERLAND. Wenn ich es schaffe, werde ich mir die Ausstellung in Brühl noch anschauen. Felicitas Kleiner hat in der letzten Nummer des Film-Dienstes eine schöne Rezension geschrieben. Mehr zur Ausstellung: the_world_of_tim_burton.html . Mehr zum Buch: 6536-0.html
09. September 2015
Frank Sinatra
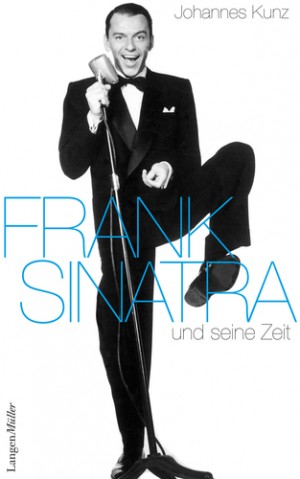 Eigentlich waren es ja zwei Karrieren, die Frank Sinatra (1915-1998) gemacht hat: eine als Sänger und eine als Schauspieler. Er hat mich auf der Leinwand zuerst als Angelo Maggio in FROM HERE TO ETERNITY von Fred Zinnemann beeindruckt, dann als Kartenspieler Frankie Machine in THE MAN WITH THE GOLDEN ARM von Otto Preminger und als erfolgloser Schriftsteller Dave Hirsch in SOME CAME RUNNING von Vincente Minnelli. Als Sänger habe ich ihn nie life erlebt. Die Biografie von Johannes Kunz, „Frank Sinatra und seine Zeit“, informiert vor allem über seine Karriere als Sänger. Das Auf und Ab hält einen als Leser ganz schön in Bewegung. Die Fakten dominieren dabei über die Interpretationen und Charakterisierungen. Natürlich spielt auch das Privatleben eine große Rolle – und sein politisches Engagement. Er war zeitlebens Mitglied der Demokratischen Partei, unterstützte aber seit den 1970er Jahren die Präsidentschaftskandidaten der Republikaner. Vor zwanzig Jahren ist bei Heyne die Biografie „Frank Sinatra – I did it my way“ von Deborah Holder erschienen. Das Buch von Johannes Kunz ist eine aktuelle Variante, die mit seinem Tod endet. Der Anhang enthält eine Lebenschronik, eine Diskographie, eine Filmographie und eine Bibliographie. Mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: frank-sinatra.html
Eigentlich waren es ja zwei Karrieren, die Frank Sinatra (1915-1998) gemacht hat: eine als Sänger und eine als Schauspieler. Er hat mich auf der Leinwand zuerst als Angelo Maggio in FROM HERE TO ETERNITY von Fred Zinnemann beeindruckt, dann als Kartenspieler Frankie Machine in THE MAN WITH THE GOLDEN ARM von Otto Preminger und als erfolgloser Schriftsteller Dave Hirsch in SOME CAME RUNNING von Vincente Minnelli. Als Sänger habe ich ihn nie life erlebt. Die Biografie von Johannes Kunz, „Frank Sinatra und seine Zeit“, informiert vor allem über seine Karriere als Sänger. Das Auf und Ab hält einen als Leser ganz schön in Bewegung. Die Fakten dominieren dabei über die Interpretationen und Charakterisierungen. Natürlich spielt auch das Privatleben eine große Rolle – und sein politisches Engagement. Er war zeitlebens Mitglied der Demokratischen Partei, unterstützte aber seit den 1970er Jahren die Präsidentschaftskandidaten der Republikaner. Vor zwanzig Jahren ist bei Heyne die Biografie „Frank Sinatra – I did it my way“ von Deborah Holder erschienen. Das Buch von Johannes Kunz ist eine aktuelle Variante, die mit seinem Tod endet. Der Anhang enthält eine Lebenschronik, eine Diskographie, eine Filmographie und eine Bibliographie. Mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: frank-sinatra.html