20. Mai 2018
DIE NEUE NATIONALGALERIE
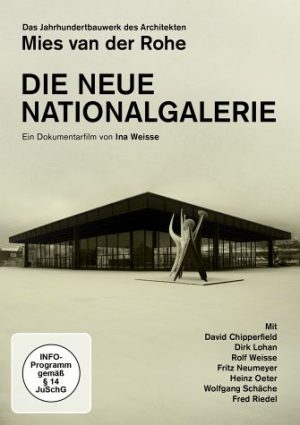 Zurzeit ist sie eine Baustelle. Auf dem Weg zum Filmhaus fahre ich regelmäßig daran vorbei. Die Wiedereröffnung der Neuen Nationalgalerie an der Pots-damer Brücke soll 2019 erfol-gen. Wer sich über die Ge-schichte dieses Gebäudes informieren will, sollte sich unbedingt den Dokumentarfilm von Ina Weisse anschauen, der jetzt bei Absolut Medien als DVD erschienen ist. Fünfzig Jahre nach der Eröffnung des Hauses erzählt er, wie das legendäre Bauwerk entstanden ist. Er ist auch ein Porträt des Architekten Mies van der Rohe mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen aus den 1960er Jahren. Protagonisten des Films sind die Architekten David Chipperfield (mit der Sanierung beauftragt), Dirk Lohan (Enkel von Mies van der Rohe), Rolf Weisse (Vater der Filmemacherin) und Fritz Neumeyer, der damalige Projektleiter Heinz Oeter, der Architekturhistoriker Wolfgang Schäche und der Stadtführer Fred Riedel. 65 spannende Minuten Architekturgeschichte. Mehr zur DVD: Die+Neue+Nationalgalerie
Zurzeit ist sie eine Baustelle. Auf dem Weg zum Filmhaus fahre ich regelmäßig daran vorbei. Die Wiedereröffnung der Neuen Nationalgalerie an der Pots-damer Brücke soll 2019 erfol-gen. Wer sich über die Ge-schichte dieses Gebäudes informieren will, sollte sich unbedingt den Dokumentarfilm von Ina Weisse anschauen, der jetzt bei Absolut Medien als DVD erschienen ist. Fünfzig Jahre nach der Eröffnung des Hauses erzählt er, wie das legendäre Bauwerk entstanden ist. Er ist auch ein Porträt des Architekten Mies van der Rohe mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen aus den 1960er Jahren. Protagonisten des Films sind die Architekten David Chipperfield (mit der Sanierung beauftragt), Dirk Lohan (Enkel von Mies van der Rohe), Rolf Weisse (Vater der Filmemacherin) und Fritz Neumeyer, der damalige Projektleiter Heinz Oeter, der Architekturhistoriker Wolfgang Schäche und der Stadtführer Fred Riedel. 65 spannende Minuten Architekturgeschichte. Mehr zur DVD: Die+Neue+Nationalgalerie
19. Mai 2018
Verfolgungsjagden
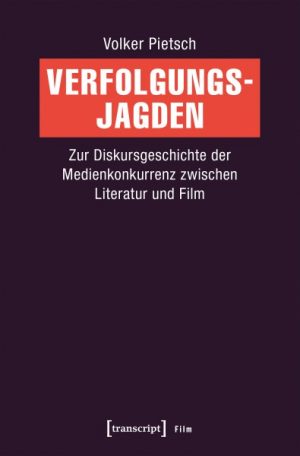 Eine Dissertation, die an der Universität Hildesheim ent-standen ist. Volker Pietsch untersucht darin die Medien-konkurrenz zwischen Literatur und Film. Hat der Film die Literatur gejagt? Drei Teile strukturieren das Buch. Im ersten Teil – Film und Literatur – wird in filmtheoretischen Texten nach Definitionen der „Filmkunst“ gesucht, in denen die Literatur zum Vergleich herangezogen wird. Eine Schlüsselrolle spielt hier die Publikation von Joachim Paech „Literatur und Film“ (1997). Besonders interessant sind die Abschnitte über „Ablenkung und Lenkung des Blickes im Bilderfluss“ und „Abmischung von Ton und Bild“, weil hier konkrete Filmbeispiele ins Spiel gebracht werden. Im zweiten Teil – „Film und Bildung“ – steht der filmpädagogische Diskurs im deutschsprachigen Raum zwischen 1978 und 2014 im Mittelpunkt. Hier verweist der Autor speziell auf einen Text von Matthias Schönleber, „Schnittstellen. Modelle für einen filmintegrativen Literaturunterricht“ (2012). Der dritte Teil – „Literatur im Film“ – ist in fünf Abschnitte unterteilt: „Konventionelle Darstellungen literarischer Werkgenese im Film“, „Leser als Filmfiguren“, „Die Unzulänglichkeit der Literatur“, „Die Legitimation des Films durch die Literatur“ und „Bücher als filmische Motive“. Auch hier sind die konkreten Filmbeispiele sehr hilfreich. Der Autor macht am Ende einen Vorschlag für die Praxis: „Spuren im Film lesen und legen“, der interessante Empfehlungen enthält. Abbildungen am Ende jedes Kapitels. Umfangreiche Literaturliste. Mehr zum Buch: verfolgungsjagden/
Eine Dissertation, die an der Universität Hildesheim ent-standen ist. Volker Pietsch untersucht darin die Medien-konkurrenz zwischen Literatur und Film. Hat der Film die Literatur gejagt? Drei Teile strukturieren das Buch. Im ersten Teil – Film und Literatur – wird in filmtheoretischen Texten nach Definitionen der „Filmkunst“ gesucht, in denen die Literatur zum Vergleich herangezogen wird. Eine Schlüsselrolle spielt hier die Publikation von Joachim Paech „Literatur und Film“ (1997). Besonders interessant sind die Abschnitte über „Ablenkung und Lenkung des Blickes im Bilderfluss“ und „Abmischung von Ton und Bild“, weil hier konkrete Filmbeispiele ins Spiel gebracht werden. Im zweiten Teil – „Film und Bildung“ – steht der filmpädagogische Diskurs im deutschsprachigen Raum zwischen 1978 und 2014 im Mittelpunkt. Hier verweist der Autor speziell auf einen Text von Matthias Schönleber, „Schnittstellen. Modelle für einen filmintegrativen Literaturunterricht“ (2012). Der dritte Teil – „Literatur im Film“ – ist in fünf Abschnitte unterteilt: „Konventionelle Darstellungen literarischer Werkgenese im Film“, „Leser als Filmfiguren“, „Die Unzulänglichkeit der Literatur“, „Die Legitimation des Films durch die Literatur“ und „Bücher als filmische Motive“. Auch hier sind die konkreten Filmbeispiele sehr hilfreich. Der Autor macht am Ende einen Vorschlag für die Praxis: „Spuren im Film lesen und legen“, der interessante Empfehlungen enthält. Abbildungen am Ende jedes Kapitels. Umfangreiche Literaturliste. Mehr zum Buch: verfolgungsjagden/
18. Mai 2018
Filmblatt 63
 Mit etwas Verspätung ist jetzt die Nummer 63 der Zeitschrift Filmblatt von CineGraph Babelsberg erschienen. Das Warten hat sich gelohnt, denn es gibt einige besonders interes-sante Texte zu lesen. Zum Beispiel den Beitrag von Joel Westerdale über Oskar Kalbus, die beiden Bände „Vom Werden deutscher Filmkunst“ (1935) und den jetzt gefundenen, nicht veröffentlichten dritten Band „Der Film im Dritten Reich“ (1937). Oder die Würdigung des deutschen Autors und Regisseurs Hans H. Zerlett von Friedemann Beyer. Anke Wilkening informiert über die neue Farbrestaurierung von Veit Harlans OPFERGANG (1944) und die verschiedenen Fassungen des Films. Raff Fluri beschäftigt sich mit der Auffindung und Rekonstruktion von Karl Ulrich Schnabels DAS KALTE HERZ (1933). Frederik Lang erinnert an die beiden Filme BIS ZUM HAPPY END (1968) und OHNE NACHSICHT (1971) von Theodor Kotulla. Bei Chris Wahl geht es um Paul Rothas Dokumentarfilm DAS LEBEN VON ADOLF HITLER (1961). Adelheid Heftberger macht auf das Online-Archiv der DFFB aufmerksam, wo 2.300 Studentenfilme zu sehen sind. Frederik Lang resümiert Ausstellung und Retrospektive von Straub-Huillet, die im vergangenen Jahr in Berlin stattgefunden haben. DVD- und Buchrezensionen runden das inhaltsreiche Heft ab. Coverfoto: Irene von Meyendorff in OPFERGANG. Mehr zum Heft: filmblatt-aktuell
Mit etwas Verspätung ist jetzt die Nummer 63 der Zeitschrift Filmblatt von CineGraph Babelsberg erschienen. Das Warten hat sich gelohnt, denn es gibt einige besonders interes-sante Texte zu lesen. Zum Beispiel den Beitrag von Joel Westerdale über Oskar Kalbus, die beiden Bände „Vom Werden deutscher Filmkunst“ (1935) und den jetzt gefundenen, nicht veröffentlichten dritten Band „Der Film im Dritten Reich“ (1937). Oder die Würdigung des deutschen Autors und Regisseurs Hans H. Zerlett von Friedemann Beyer. Anke Wilkening informiert über die neue Farbrestaurierung von Veit Harlans OPFERGANG (1944) und die verschiedenen Fassungen des Films. Raff Fluri beschäftigt sich mit der Auffindung und Rekonstruktion von Karl Ulrich Schnabels DAS KALTE HERZ (1933). Frederik Lang erinnert an die beiden Filme BIS ZUM HAPPY END (1968) und OHNE NACHSICHT (1971) von Theodor Kotulla. Bei Chris Wahl geht es um Paul Rothas Dokumentarfilm DAS LEBEN VON ADOLF HITLER (1961). Adelheid Heftberger macht auf das Online-Archiv der DFFB aufmerksam, wo 2.300 Studentenfilme zu sehen sind. Frederik Lang resümiert Ausstellung und Retrospektive von Straub-Huillet, die im vergangenen Jahr in Berlin stattgefunden haben. DVD- und Buchrezensionen runden das inhaltsreiche Heft ab. Coverfoto: Irene von Meyendorff in OPFERGANG. Mehr zum Heft: filmblatt-aktuell
16. Mai 2018
Ein Arbeitsleben für die DEFA
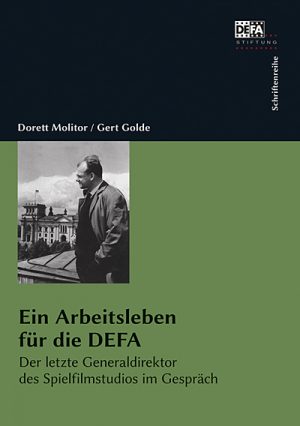 Gert Golde (*1937 in Dresden) war der letzte Generaldirektor des DEFA-Spielfilmstudios und sein Leben lang mit der Film-firma der DDR eng verbunden. Über mehre Wochen hat er ein Gespräch mit der Sammlungs-leiterin des Potsdamer Film-museums, Dorett Molitor, geführt, in dem er sich an die verschiedenen Stationen und Verantwortlichkeiten seines Berufslebens erinnert. Es ist jetzt in der Schriftenreihe der DEFA-Stiftung als Buch publiziert worden und erweist sich als hochinteressante Lektüre, weil man eigentlich wenig über die Produktionshintergründe des Studios weiß. Golde hat von 1955-59 die Filmhochschule in Babelsberg besucht, war als junger Produktions-leiter u.a. an den Filmen CHRISTINE (1963) von Slatan Dudow und KARLA (1965/66) von Herrmann Zschoche beteiligt, wurde 1966 „Hauptökonom“ des DEFA-Studios für Spielfilme, drei Jahre später „Direktor für Ökonomie“, arbeitete in den 1970er und 80er Jahren als Direktor für Produktion, war Erster Stellvertreter des Generaldirektors, übernahm die Generaldirektion am 1. September 1989 und wirkte verantwortlich an der Umwandlung vom Volkseigenen Betrieb in eine GmbH mit. Doritt Molitor hat sich auf das Gespräch hervorragend vorbereitet, Gert Golde verfügt über ein sehr gutes Erinnerungs-vermögen. Daraus resultiert ein Text, in dem natürlich politische Konflikte, aber auch die Rolle der Dramaturgen und der Künstlerischen Arbeitsgruppen, die technische Ausstattung, das Verhältnis zum Fernsehen der DDR, zu den westlichen Ländern, Spannungen zwischen den Regie-Generationen und die Hierarchien im Produktionsbereich zur Sprache kommen. Das geschieht sehr konkret und macht die Lektüre spannend. Umfang des Gesprächs: 240 Seiten (mit Abbildungen). Der Anhang enthält auf 100 Seiten 24 Dokumente aus der Zeit von 1957 bis 1992. Mehr zum Buch: arbeitsleben.html
Gert Golde (*1937 in Dresden) war der letzte Generaldirektor des DEFA-Spielfilmstudios und sein Leben lang mit der Film-firma der DDR eng verbunden. Über mehre Wochen hat er ein Gespräch mit der Sammlungs-leiterin des Potsdamer Film-museums, Dorett Molitor, geführt, in dem er sich an die verschiedenen Stationen und Verantwortlichkeiten seines Berufslebens erinnert. Es ist jetzt in der Schriftenreihe der DEFA-Stiftung als Buch publiziert worden und erweist sich als hochinteressante Lektüre, weil man eigentlich wenig über die Produktionshintergründe des Studios weiß. Golde hat von 1955-59 die Filmhochschule in Babelsberg besucht, war als junger Produktions-leiter u.a. an den Filmen CHRISTINE (1963) von Slatan Dudow und KARLA (1965/66) von Herrmann Zschoche beteiligt, wurde 1966 „Hauptökonom“ des DEFA-Studios für Spielfilme, drei Jahre später „Direktor für Ökonomie“, arbeitete in den 1970er und 80er Jahren als Direktor für Produktion, war Erster Stellvertreter des Generaldirektors, übernahm die Generaldirektion am 1. September 1989 und wirkte verantwortlich an der Umwandlung vom Volkseigenen Betrieb in eine GmbH mit. Doritt Molitor hat sich auf das Gespräch hervorragend vorbereitet, Gert Golde verfügt über ein sehr gutes Erinnerungs-vermögen. Daraus resultiert ein Text, in dem natürlich politische Konflikte, aber auch die Rolle der Dramaturgen und der Künstlerischen Arbeitsgruppen, die technische Ausstattung, das Verhältnis zum Fernsehen der DDR, zu den westlichen Ländern, Spannungen zwischen den Regie-Generationen und die Hierarchien im Produktionsbereich zur Sprache kommen. Das geschieht sehr konkret und macht die Lektüre spannend. Umfang des Gesprächs: 240 Seiten (mit Abbildungen). Der Anhang enthält auf 100 Seiten 24 Dokumente aus der Zeit von 1957 bis 1992. Mehr zum Buch: arbeitsleben.html
15. Mai 2018
Queer Cinema
 Ein Sammelband mit 15 Texten, zwei Gesprächen und einem basislegenden Vorwort. Aus-gangspunkt ist der vor 25 Jahren erschienene wegweisende Artikel von B. Ruby Rich „New Queer Cinema“, der hier in der erwei-terten Form eines „Director’s Cut“ publiziert wird. Skadi Loist gibt einen Überblick über „Queer Cinema Studies“. Chris Tedjasukmana erinnert an Sylvia Rivera. Henriette Gunkel verbindet das queere Kino mit dem Afrofuturismus. Jim Hubbard beschäftigt sich mit dem AIDS-Videoaktivismus und der Entstehung des „Archivs“. Cheryl Dunye unternimmt einen Ausflug zu einigen Stationen des Black Experimental Cinema. Elahe Haschemai Yekani erforscht die lesbische Repräsentation im Spannungsfeld von New Wave Queer Cinema und Homonormativität. Jan Künemund äußert sich zu queeren Ich-Entwürfen in filmischen Biografien. Robin K. Saalfeld befasst sich mit der filmästhetischen Vermittlung von Transgeschlechtlichkeit am Beispiel von Tom Hoopers THE DANISH GIRL. Florian Krauß informiert über Transgender-Repräsentationen in der Webserie TRANSPARENT. Natascha Frankenberg fragt „Wann und wo wird queerer Film gewesen sein?“. Die Experimentalfilmerin Barbara Hammer erneuert ihre Forderung, dass radikaler Inhalt radikale Form verlangt. Daniel Kulle richtet seinen Blick auf die ästhetischen Strategien des queeren Experimentalfilms. Bei Alice Kuzniar geht es um den Film PRINZ IN HÖLLELAND von Michael Stock. Peter Rehberg fragt „Ist der Schwulenporno queer?“. Zwei Gespräche hat die Co-Herausgeberin Dagmar Brunow geführt: mit Monika Treut und Angelina Maccarone. Aus dem Spektrum aller Beiträge ist eine Basispublikation zum Thema „Queer Cinema“ entstanden. Beeindruckend. Mehr zum Buch: 1813/queer-cinema
Ein Sammelband mit 15 Texten, zwei Gesprächen und einem basislegenden Vorwort. Aus-gangspunkt ist der vor 25 Jahren erschienene wegweisende Artikel von B. Ruby Rich „New Queer Cinema“, der hier in der erwei-terten Form eines „Director’s Cut“ publiziert wird. Skadi Loist gibt einen Überblick über „Queer Cinema Studies“. Chris Tedjasukmana erinnert an Sylvia Rivera. Henriette Gunkel verbindet das queere Kino mit dem Afrofuturismus. Jim Hubbard beschäftigt sich mit dem AIDS-Videoaktivismus und der Entstehung des „Archivs“. Cheryl Dunye unternimmt einen Ausflug zu einigen Stationen des Black Experimental Cinema. Elahe Haschemai Yekani erforscht die lesbische Repräsentation im Spannungsfeld von New Wave Queer Cinema und Homonormativität. Jan Künemund äußert sich zu queeren Ich-Entwürfen in filmischen Biografien. Robin K. Saalfeld befasst sich mit der filmästhetischen Vermittlung von Transgeschlechtlichkeit am Beispiel von Tom Hoopers THE DANISH GIRL. Florian Krauß informiert über Transgender-Repräsentationen in der Webserie TRANSPARENT. Natascha Frankenberg fragt „Wann und wo wird queerer Film gewesen sein?“. Die Experimentalfilmerin Barbara Hammer erneuert ihre Forderung, dass radikaler Inhalt radikale Form verlangt. Daniel Kulle richtet seinen Blick auf die ästhetischen Strategien des queeren Experimentalfilms. Bei Alice Kuzniar geht es um den Film PRINZ IN HÖLLELAND von Michael Stock. Peter Rehberg fragt „Ist der Schwulenporno queer?“. Zwei Gespräche hat die Co-Herausgeberin Dagmar Brunow geführt: mit Monika Treut und Angelina Maccarone. Aus dem Spektrum aller Beiträge ist eine Basispublikation zum Thema „Queer Cinema“ entstanden. Beeindruckend. Mehr zum Buch: 1813/queer-cinema
14. Mai 2018
Yasujiro Ozu
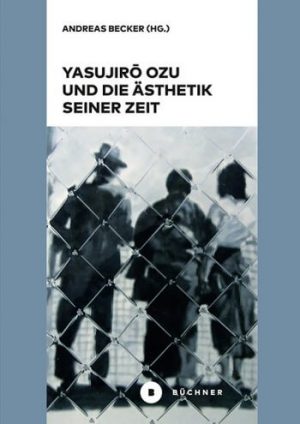 Der Band dokumentiert die Beiträge zu einem Symposium, das 2016 in Frankfurt am Main stattgefunden hat. Es geht dabei vor allem um Ozus Filme der 30er und 40er Jahre. Jörg Schweinitz beschäftigt sich mit dem Film VERGNÜGTER SPA-ZIERGANG (1930): „Gangster, dampfende Kessel und die poetische Aneignung trans-nationaler Erfahrungen mit dem Kino“. Kerstin Fooken richtet ihren Blick auf EINE FRAU AUS TOKIO (1933) und die frühen Stars des japanischen Films. Andreas Becker interpretiert speziell die Lubitsch-Sequenz aus diesem Film: „Wenn die Frau aus Tokio eine Million hätte“. Kayo Adachi-Rabe verbindet das Werk von Ozu mit der Gedankenwelt des japanischen Philosophen Shuzo Kuki: „Die Struktur des Schicks im Film“. Woojeong Joo informiert in seinem Text (in englischer Sprache) über Ozu in der Kriegszeit: „From Nostalgia into Reality“. Marcos P. Centeno Martín vergleicht (ebenfalls in Englisch) die künstlerischen Methoden von Susumi Hani und Ozu: „A Comparative Approach across Paradigms“. Bei Stefanie Kreuzer geht es um das Essen in den Filmen BREAKFAST AT TIFFANY’S von Blake Edwards und DER GESCHMACK VON GRÜNEM TEE ÜBER REIS von Ozu: „Einfach(es) Essen im Film?“. Hoch interessant finde ich den Text von Simon Frisch über die verspätete Ozu-Rezeption in Westeuropa: „Japanizität oder filmische Ästhetik?“. Ich habe in allen Beiträgen neue Informationen über Ozu gefunden, die mein Wissen über ihn erweitert haben. Mit wenigen Abbildungen. Mehr zum Buch: yasujiro-ozu-und-die-aesthetik-seiner-zeit/
Der Band dokumentiert die Beiträge zu einem Symposium, das 2016 in Frankfurt am Main stattgefunden hat. Es geht dabei vor allem um Ozus Filme der 30er und 40er Jahre. Jörg Schweinitz beschäftigt sich mit dem Film VERGNÜGTER SPA-ZIERGANG (1930): „Gangster, dampfende Kessel und die poetische Aneignung trans-nationaler Erfahrungen mit dem Kino“. Kerstin Fooken richtet ihren Blick auf EINE FRAU AUS TOKIO (1933) und die frühen Stars des japanischen Films. Andreas Becker interpretiert speziell die Lubitsch-Sequenz aus diesem Film: „Wenn die Frau aus Tokio eine Million hätte“. Kayo Adachi-Rabe verbindet das Werk von Ozu mit der Gedankenwelt des japanischen Philosophen Shuzo Kuki: „Die Struktur des Schicks im Film“. Woojeong Joo informiert in seinem Text (in englischer Sprache) über Ozu in der Kriegszeit: „From Nostalgia into Reality“. Marcos P. Centeno Martín vergleicht (ebenfalls in Englisch) die künstlerischen Methoden von Susumi Hani und Ozu: „A Comparative Approach across Paradigms“. Bei Stefanie Kreuzer geht es um das Essen in den Filmen BREAKFAST AT TIFFANY’S von Blake Edwards und DER GESCHMACK VON GRÜNEM TEE ÜBER REIS von Ozu: „Einfach(es) Essen im Film?“. Hoch interessant finde ich den Text von Simon Frisch über die verspätete Ozu-Rezeption in Westeuropa: „Japanizität oder filmische Ästhetik?“. Ich habe in allen Beiträgen neue Informationen über Ozu gefunden, die mein Wissen über ihn erweitert haben. Mit wenigen Abbildungen. Mehr zum Buch: yasujiro-ozu-und-die-aesthetik-seiner-zeit/
13. Mai 2018
Zwei Western
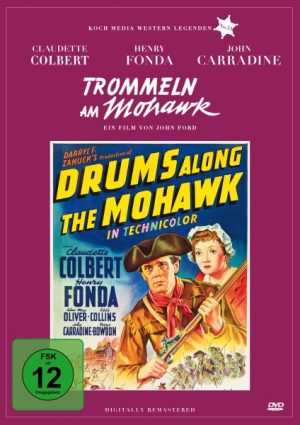 Zwei neue Western-Legenden von Koch Media. DRUMS ALONG THE MOHAWK (1939) von John Ford erzählt eine Familiengeschichte aus der Zeit des Unabhängigkeitskrie-ges. Gil Martin (Henry Fonda) und seine junge Frau Lana (Claudette Colbert) geraten auf ihrer kleinen Farm im Mohawk Valley in viel-fache Bedrängnis, Indianer bren-nen die Farm nieder, Lana verliert ihr Baby, Gil muss in den Krieg ziehen, wird totgesagt, aber von Lana gerettet, Lana ist erneut schwanger, ein englischer Agent (John Carradine) animiert hunderte Indianer zu einem Angriff auf das Fort, wo sich die Farmer verschanzt haben, Gil holt Verstärkung, am Ende kann er Frau und Kind in den Arm nehmen. John Fords erster Farbfilm. Bert Glennon hat wunder-bare Bilder gemacht, mit poetischen Momenten und vielen realistischen Details, die uns emotional berühren. Die Musik von Alfred Newman verstärkt die Stimmungen. Eindrucksvolle Schauspieler*innen, in Nebenrollen sehen wir Edna May Oliver, Ward Bond, Russell Simpson und Chief Big Tree. Die DVD hat eine gute Bildqualität. Zu den Extras gehört die Dokumentation BECOMING JOHN FORD (2007) von Nick Redman und Julie Kirgo (93 min.). Das Booklet enthält einen schönen Text von Fritz Göttler. Mehr zur DVD: legenden_51_dvd/
Zwei neue Western-Legenden von Koch Media. DRUMS ALONG THE MOHAWK (1939) von John Ford erzählt eine Familiengeschichte aus der Zeit des Unabhängigkeitskrie-ges. Gil Martin (Henry Fonda) und seine junge Frau Lana (Claudette Colbert) geraten auf ihrer kleinen Farm im Mohawk Valley in viel-fache Bedrängnis, Indianer bren-nen die Farm nieder, Lana verliert ihr Baby, Gil muss in den Krieg ziehen, wird totgesagt, aber von Lana gerettet, Lana ist erneut schwanger, ein englischer Agent (John Carradine) animiert hunderte Indianer zu einem Angriff auf das Fort, wo sich die Farmer verschanzt haben, Gil holt Verstärkung, am Ende kann er Frau und Kind in den Arm nehmen. John Fords erster Farbfilm. Bert Glennon hat wunder-bare Bilder gemacht, mit poetischen Momenten und vielen realistischen Details, die uns emotional berühren. Die Musik von Alfred Newman verstärkt die Stimmungen. Eindrucksvolle Schauspieler*innen, in Nebenrollen sehen wir Edna May Oliver, Ward Bond, Russell Simpson und Chief Big Tree. Die DVD hat eine gute Bildqualität. Zu den Extras gehört die Dokumentation BECOMING JOHN FORD (2007) von Nick Redman und Julie Kirgo (93 min.). Das Booklet enthält einen schönen Text von Fritz Göttler. Mehr zur DVD: legenden_51_dvd/
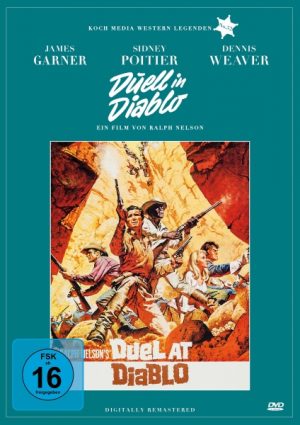 DUEL AT DIABLO (1965) von Ralph Nelson erzählt von Aus-einandersetzungen zwischen Indianern und Einwanderern. Drei Männer und eine Frau stehen im Mittelpunkt. Der Scout Jess Rem-berg (gespielt von James Garner) will den Tod seiner Comanchen-Frau rächen, die von einem unbe-kannten weißen Mann getötet und skalpiert wurde. Der Krämer Willard Grange (Dennis Weaver) ist ein Indianer-Hasser. Seine Frau Ellen (Bibi Andersson) wurde ein Jahr von den Apachen gefangen gehalten und von Jess befreit. Der schwarze Ex-Kavallerist Toller (Sidney Poitier) variiert zwischen den Fronten. Ein Soldatentrupp, begleitet von Jess, Willard und Toller, macht sich auf den Weg zum Fort Concho. Die Indianer legen einen Hinterhalt, es gibt Tote, die Wasservorräte gehen zur Neige, Jess übernimmt die Führung, die Konflikte untereinander verstärken sich, am Ende stellt sich natürlich heraus, dass Willard die Frau von Jess getötet hat. Das ist spannend erzählt und sehr professionell gespielt. Zur DVD gehört ein Booklet, wiederum mit einem sehr lesenswerten Text von Fritz Göttler. Mehr zur DVD: legenden_52_dvd/
DUEL AT DIABLO (1965) von Ralph Nelson erzählt von Aus-einandersetzungen zwischen Indianern und Einwanderern. Drei Männer und eine Frau stehen im Mittelpunkt. Der Scout Jess Rem-berg (gespielt von James Garner) will den Tod seiner Comanchen-Frau rächen, die von einem unbe-kannten weißen Mann getötet und skalpiert wurde. Der Krämer Willard Grange (Dennis Weaver) ist ein Indianer-Hasser. Seine Frau Ellen (Bibi Andersson) wurde ein Jahr von den Apachen gefangen gehalten und von Jess befreit. Der schwarze Ex-Kavallerist Toller (Sidney Poitier) variiert zwischen den Fronten. Ein Soldatentrupp, begleitet von Jess, Willard und Toller, macht sich auf den Weg zum Fort Concho. Die Indianer legen einen Hinterhalt, es gibt Tote, die Wasservorräte gehen zur Neige, Jess übernimmt die Führung, die Konflikte untereinander verstärken sich, am Ende stellt sich natürlich heraus, dass Willard die Frau von Jess getötet hat. Das ist spannend erzählt und sehr professionell gespielt. Zur DVD gehört ein Booklet, wiederum mit einem sehr lesenswerten Text von Fritz Göttler. Mehr zur DVD: legenden_52_dvd/
12. Mai 2018
Ruth Hellberg
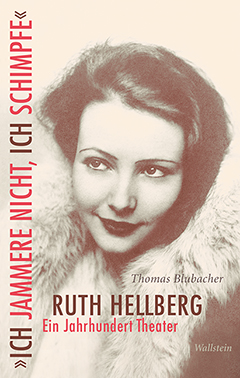 Sie agierte mehr auf der Bühne als vor der Kamera. Ruth Hell-berg (1906-2001) hat als Schau-spielerin in Deutschland ein erlebnisreiches Leben geführt, das uns Thomas Blubacher – Autor einer beeindruckenden Gustaf Gründgens-Biografie – mit seinem neuen Buch in Erinnerung ruft. Sie war offen-bar eine selbstbewusste Person, uneheliche Tochter einer Schau-spielerin und eines Theater-intendanten, verließ früh die Schule, um Schauspielerin zu werden, debütierte in Meiningen, zog mit der Theatertruppe von Hans Holtorf durch die Provinz und verschaffte sich ein Engagement bei den Münchener Kammerspielen unter Otto Falckenberg. Damit begann ihre Karriere. In den 1930er Jahren drehte sie ihre wichtigsten Filme, darunter YVETTE von Wolfgang Liebeneiner, HEIMAT von Carl Froelich, DREI UNTEROFFIZIERE von Werner Hochbaum. Von 1934 bis 1944 war sie mit Wolfgang Liebeneiner verheiratet. Hörbar war sie als Synchronsprecherin von Vivien Leigh, Myrna Loy, Elisabeth Bergner und Jeanne Moreau über viele Jahrzehnte. Nach Kriegsende spielte sie vorwiegend Theater u.a. in Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Hamburg und München. In ihrer letzten Filmrolle war sie die Mutter von Karin Baal und Barbara Auer in Hermine Huntgeburths Film IM KREIS DER LIEBEN (1991). Ich habe Ruth Hellberg einige Male auf der Bühne gesehen und schätze auch ihre Filmarbeit. Thomas Blubacher hat hervorragend recherchiert, in den Anmerkungen (über 100 Seiten) findet man viele interessante Kurzbiografien. Mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: ruth-hellberg.html
Sie agierte mehr auf der Bühne als vor der Kamera. Ruth Hell-berg (1906-2001) hat als Schau-spielerin in Deutschland ein erlebnisreiches Leben geführt, das uns Thomas Blubacher – Autor einer beeindruckenden Gustaf Gründgens-Biografie – mit seinem neuen Buch in Erinnerung ruft. Sie war offen-bar eine selbstbewusste Person, uneheliche Tochter einer Schau-spielerin und eines Theater-intendanten, verließ früh die Schule, um Schauspielerin zu werden, debütierte in Meiningen, zog mit der Theatertruppe von Hans Holtorf durch die Provinz und verschaffte sich ein Engagement bei den Münchener Kammerspielen unter Otto Falckenberg. Damit begann ihre Karriere. In den 1930er Jahren drehte sie ihre wichtigsten Filme, darunter YVETTE von Wolfgang Liebeneiner, HEIMAT von Carl Froelich, DREI UNTEROFFIZIERE von Werner Hochbaum. Von 1934 bis 1944 war sie mit Wolfgang Liebeneiner verheiratet. Hörbar war sie als Synchronsprecherin von Vivien Leigh, Myrna Loy, Elisabeth Bergner und Jeanne Moreau über viele Jahrzehnte. Nach Kriegsende spielte sie vorwiegend Theater u.a. in Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Hamburg und München. In ihrer letzten Filmrolle war sie die Mutter von Karin Baal und Barbara Auer in Hermine Huntgeburths Film IM KREIS DER LIEBEN (1991). Ich habe Ruth Hellberg einige Male auf der Bühne gesehen und schätze auch ihre Filmarbeit. Thomas Blubacher hat hervorragend recherchiert, in den Anmerkungen (über 100 Seiten) findet man viele interessante Kurzbiografien. Mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: ruth-hellberg.html
11. Mai 2018
Helge Schneider
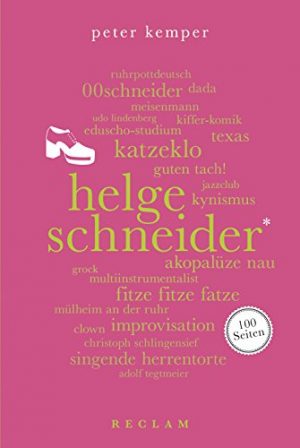 Er ist vielseitig kreativ: als Sän-ger, Musiker, Schauspieler, Autor, Zeichner, Filmemacher. Helge Schneider (*1955 in Mühlheim an der Ruhr) gilt als Multitalent. In der 100-Seiten-Reihe des Reclam Verlages würdigt ihn Peter Kemper mit einem sehr zugeneigten Text, der die einzelnen Tätigkeiten kenntnisreich und differenziert darstellt. Natürlich habe ich JOHNNY FLASH (1986) von Werner Nekes, MENU TOTAL (1986) von Christof Schlingen-sief und MEIN FÜHRER (2007) von Dani Levy gesehen, in denen Helge Schneider jeweils die Hauptrolle spielte, aber ich war nie ein Fan von ihm. TEXAS – DOC SCHNEIDER HÄLT DIE WELT IN ATEM (1993) fand ich originell, seine vier anderen Regiefilme kenne ich nicht. Das kleine Buch hat mich neugierig gemacht. Zunächst werde ich einen seiner Kriminalromane lesen, dann sehen wir weiter. Mehr zum Buch: Peter/Helge_Schneider__100_Seiten
Er ist vielseitig kreativ: als Sän-ger, Musiker, Schauspieler, Autor, Zeichner, Filmemacher. Helge Schneider (*1955 in Mühlheim an der Ruhr) gilt als Multitalent. In der 100-Seiten-Reihe des Reclam Verlages würdigt ihn Peter Kemper mit einem sehr zugeneigten Text, der die einzelnen Tätigkeiten kenntnisreich und differenziert darstellt. Natürlich habe ich JOHNNY FLASH (1986) von Werner Nekes, MENU TOTAL (1986) von Christof Schlingen-sief und MEIN FÜHRER (2007) von Dani Levy gesehen, in denen Helge Schneider jeweils die Hauptrolle spielte, aber ich war nie ein Fan von ihm. TEXAS – DOC SCHNEIDER HÄLT DIE WELT IN ATEM (1993) fand ich originell, seine vier anderen Regiefilme kenne ich nicht. Das kleine Buch hat mich neugierig gemacht. Zunächst werde ich einen seiner Kriminalromane lesen, dann sehen wir weiter. Mehr zum Buch: Peter/Helge_Schneider__100_Seiten
10. Mai 2018
Die Odyssee der Drehbuchschreiber
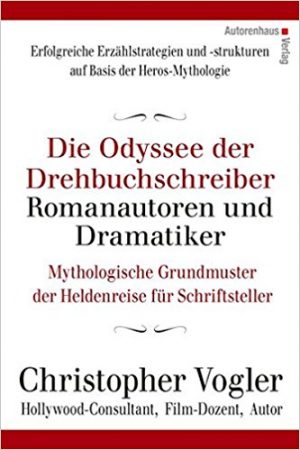 Christopher Vogler ist Story-Editor von 20th Century Fox und Dozent an der University of Southern California, er kennt die Strukturen erfolgreicher Drehbücher und erzählt hier die Grundmuster einer „Heldenreise“. Seine theoretischen Paten sind der Mythenforscher Joseph Campbell und der Psycho-loge C. G. Jung. Das Buch entstand 1998, wurde damals auch ins Deutsche übersetzt, die vorliegende Ausgabe stammt aus dem Jahr 2010 und wurde jetzt im Autorenhaus Verlag neu herausgegeben. Der Text endet mit sechs Fragen, die nach Meinung des Autors schon immer die Mythen beherrscht haben: „Wer bin ich? Woher komme ich? Was wird geschehen, wenn ich sterbe? Was ist der Sinn von alledem? Wo ist mein Platz in dieser Welt? Wohin wird meine eigene Reise des Helden mich führen?“. Der Text (400 Seiten) teilt sich in zwei „Bücher“: „Die Reise“ (Praktische Einführung, Die Archetypen, Der Held, Der Mentor: weiser alter Mann, weise alte Frau, Der Schwellenhüter, Der Herold, Der Gestaltwandler, Der Schatten, Der Trickster) und „Stadien der Reise“ (insgesamt zwölf und ein Rückblick). Filmbeispiele, die vom Autor oft herangezogen werden, sind: THE WIZARD OF OZ (1939) von Victor Fleming, STAR WARS (1977) von George Lucas, ROMANCING THE STONE (1984) von Robert Zemeckis, BEVERLY HILLS COP (1984) von Martin Brest, FATAL ATTRACTION (1987) von Adrian Lyne, THE SILENCE OF THE LAMBS (1988) von Jonathan Demme, DANCES WITH WOLVES (1990) von Kevin Costner, THE LION KING (1994) aus den Disney-Studios und TITANIC (1997) von James Cameron. Dramaturgische Veränderungen der vergangenen zwanzig Jahre im Zusammenhang mit TV-Serien spielen keine Rolle. Ein Klassiker der Drehbuchliteratur. Keine Abbildungen. Mehr zum Buch: grundmuster-für-schriftsteller.phtml
Christopher Vogler ist Story-Editor von 20th Century Fox und Dozent an der University of Southern California, er kennt die Strukturen erfolgreicher Drehbücher und erzählt hier die Grundmuster einer „Heldenreise“. Seine theoretischen Paten sind der Mythenforscher Joseph Campbell und der Psycho-loge C. G. Jung. Das Buch entstand 1998, wurde damals auch ins Deutsche übersetzt, die vorliegende Ausgabe stammt aus dem Jahr 2010 und wurde jetzt im Autorenhaus Verlag neu herausgegeben. Der Text endet mit sechs Fragen, die nach Meinung des Autors schon immer die Mythen beherrscht haben: „Wer bin ich? Woher komme ich? Was wird geschehen, wenn ich sterbe? Was ist der Sinn von alledem? Wo ist mein Platz in dieser Welt? Wohin wird meine eigene Reise des Helden mich führen?“. Der Text (400 Seiten) teilt sich in zwei „Bücher“: „Die Reise“ (Praktische Einführung, Die Archetypen, Der Held, Der Mentor: weiser alter Mann, weise alte Frau, Der Schwellenhüter, Der Herold, Der Gestaltwandler, Der Schatten, Der Trickster) und „Stadien der Reise“ (insgesamt zwölf und ein Rückblick). Filmbeispiele, die vom Autor oft herangezogen werden, sind: THE WIZARD OF OZ (1939) von Victor Fleming, STAR WARS (1977) von George Lucas, ROMANCING THE STONE (1984) von Robert Zemeckis, BEVERLY HILLS COP (1984) von Martin Brest, FATAL ATTRACTION (1987) von Adrian Lyne, THE SILENCE OF THE LAMBS (1988) von Jonathan Demme, DANCES WITH WOLVES (1990) von Kevin Costner, THE LION KING (1994) aus den Disney-Studios und TITANIC (1997) von James Cameron. Dramaturgische Veränderungen der vergangenen zwanzig Jahre im Zusammenhang mit TV-Serien spielen keine Rolle. Ein Klassiker der Drehbuchliteratur. Keine Abbildungen. Mehr zum Buch: grundmuster-für-schriftsteller.phtml