10. Mai 2015
CHARLEY VARRICK (1973)
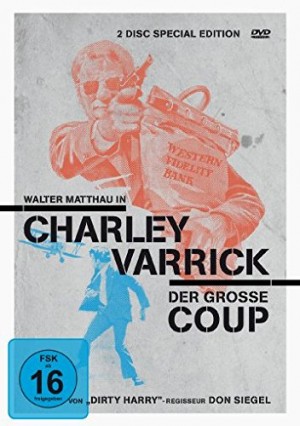 Charley Varrick (gespielt von Walter Matthau) war mal ein Kunstflieger, jobbt jetzt als Schäd-lingsbekämpfer und besorgt sich ein bisschen zusätzliches Geld durch kleine Banküberfälle. Ein geplanter Raub in New Mexiko gerät außer Kontrolle, als Varricks Frau Nadine und zwei Kumpel unvermittelt mit der Polizei in Konflikt kommen. Nadine erschießt zwei Polizisten, ein Kumpel und ein Wachmann werden getötet, Charley kann mit dem anderen Kumpel entkommen. Ihre Beute: mehr als 750.000 $. Das Geld wird für sie gefährlich, weil es für die mafiöse Cosa Nostra bestimmt war. Und die beiden bekommen es nun mit dem Auftragsmörder Molly zu tun. Dieser Thriller von Don Siegel, gedreht unmittelbar nach DIRTY HARRY, wurde in den 70er Jahren leider unterschätzt. Er hat viele formale Qualitäten, ist spannend bis zum Ende und hat mit Matthau einen interessanten Hauptdarsteller, der hier keinerlei Faxen macht. Koch Media hat CHARLEY VARRICK (deutscher Titel: DER GROSSE COUP) jetzt als DVD in einer Special Edition veröffentlicht. Neben dem digitalisierten Film gehört dazu eine 72minütige Dokumentation von Robert Fischer: LAST OF THE INDEPENDENTS (das war im Übrigen auch der Arbeitstitel des Films). Fischer hat Interviews geführt mit Don Siegels Sohn Kristoffer Tabori, dem Stunt-Director Craig R. Baxley, dem Drehbuchautor Howard A. Rodman, dem Komponisten Lalo Schifrin, dem Darsteller Andy Robinson (er spielt den Kumpel Harman, mit dem Charley relativ lange unterwegs ist) und der Schauspielerin Jacqueline Scott (sie spielt Varricks Frau Nadine). Die Interviews sind gut strukturiert, öffnen den Blick für Produktionshintergründe und sind von einem großen Respekt für die Regieleistung von Don Siegel geprägt. Mehr zur DVD: 1009222&nav1=FILM
Charley Varrick (gespielt von Walter Matthau) war mal ein Kunstflieger, jobbt jetzt als Schäd-lingsbekämpfer und besorgt sich ein bisschen zusätzliches Geld durch kleine Banküberfälle. Ein geplanter Raub in New Mexiko gerät außer Kontrolle, als Varricks Frau Nadine und zwei Kumpel unvermittelt mit der Polizei in Konflikt kommen. Nadine erschießt zwei Polizisten, ein Kumpel und ein Wachmann werden getötet, Charley kann mit dem anderen Kumpel entkommen. Ihre Beute: mehr als 750.000 $. Das Geld wird für sie gefährlich, weil es für die mafiöse Cosa Nostra bestimmt war. Und die beiden bekommen es nun mit dem Auftragsmörder Molly zu tun. Dieser Thriller von Don Siegel, gedreht unmittelbar nach DIRTY HARRY, wurde in den 70er Jahren leider unterschätzt. Er hat viele formale Qualitäten, ist spannend bis zum Ende und hat mit Matthau einen interessanten Hauptdarsteller, der hier keinerlei Faxen macht. Koch Media hat CHARLEY VARRICK (deutscher Titel: DER GROSSE COUP) jetzt als DVD in einer Special Edition veröffentlicht. Neben dem digitalisierten Film gehört dazu eine 72minütige Dokumentation von Robert Fischer: LAST OF THE INDEPENDENTS (das war im Übrigen auch der Arbeitstitel des Films). Fischer hat Interviews geführt mit Don Siegels Sohn Kristoffer Tabori, dem Stunt-Director Craig R. Baxley, dem Drehbuchautor Howard A. Rodman, dem Komponisten Lalo Schifrin, dem Darsteller Andy Robinson (er spielt den Kumpel Harman, mit dem Charley relativ lange unterwegs ist) und der Schauspielerin Jacqueline Scott (sie spielt Varricks Frau Nadine). Die Interviews sind gut strukturiert, öffnen den Blick für Produktionshintergründe und sind von einem großen Respekt für die Regieleistung von Don Siegel geprägt. Mehr zur DVD: 1009222&nav1=FILM
09. Mai 2015
DIE LANGEN HELLEN TAGE (2014)
 Dies ist ein Film aus Georgien, der im vergangenen Jahr dreißig Festivalpreise erhielt und sogar für den Oscar nominiert wurde. Ich habe ihn im Kino versäumt und jetzt erst – dank der DVD von Absolut Medien – gesehen. Ich bin sehr beeindruckt, wie Nana Ekvtimishvili und Simon Groß die Geschichte der beiden Freundinnen Eka und Natja aus dem Sommer 1992 in Tiflis erzählen: in weitgehend ruhigen Einstellungen, genau beobachtend, in einer großen Nähe zu den beiden Protagonistinnen. Eka und Natja sind 14, selbstbewusst, auf der Suche nach einer eigenständigen Zukunft. Sie haben auch miteinander Konflikte, aber die Freundschaft zwischen ihnen ist eng. Eine Pistole, die Eka von einem Freund geschenkt bekommt, wird zum Austauschobjekt. Denn Gewalt ist im postsowjetischen Georgien eine Grundstimmung. Da sie in ihren Familien nicht beschützt werden, halten sich Eka und Natja aneinander fest in ihrer Freundschaft. In den Familien, auf den Straßen, in der Schule sind ständig Aggressionen zu spüren. Ekas Vater sitzt im Gefängnis, am Ende des Films besucht sie ihn dort. Natjas große Liebe, der sanfte Lado wird zu einem Opfer der Gewalt. Die Darsteller sind weitgehend Laien. Lika Babluani (Eka) und Mariam Bokeria (Natja) wurden in der Schule gecastet. Sie sind faszinierend im Zusammenspiel, aber auch in ihren Einzelszenen. Der rumänische Kameramann Oleg Mutu hat daran einen hohen Anteil. Nana Ekvtimishvili stammt aus Georgien und hat an der HFF ‚Konrad Wolf’ in Potsdam studiert, Simon Groß ist Berliner und hat die HFF München absolviert. Ich hoffe, sie können weitere Filme machen. Mehr zur DVD: 7014/Die+langen+hellen+Tage
Dies ist ein Film aus Georgien, der im vergangenen Jahr dreißig Festivalpreise erhielt und sogar für den Oscar nominiert wurde. Ich habe ihn im Kino versäumt und jetzt erst – dank der DVD von Absolut Medien – gesehen. Ich bin sehr beeindruckt, wie Nana Ekvtimishvili und Simon Groß die Geschichte der beiden Freundinnen Eka und Natja aus dem Sommer 1992 in Tiflis erzählen: in weitgehend ruhigen Einstellungen, genau beobachtend, in einer großen Nähe zu den beiden Protagonistinnen. Eka und Natja sind 14, selbstbewusst, auf der Suche nach einer eigenständigen Zukunft. Sie haben auch miteinander Konflikte, aber die Freundschaft zwischen ihnen ist eng. Eine Pistole, die Eka von einem Freund geschenkt bekommt, wird zum Austauschobjekt. Denn Gewalt ist im postsowjetischen Georgien eine Grundstimmung. Da sie in ihren Familien nicht beschützt werden, halten sich Eka und Natja aneinander fest in ihrer Freundschaft. In den Familien, auf den Straßen, in der Schule sind ständig Aggressionen zu spüren. Ekas Vater sitzt im Gefängnis, am Ende des Films besucht sie ihn dort. Natjas große Liebe, der sanfte Lado wird zu einem Opfer der Gewalt. Die Darsteller sind weitgehend Laien. Lika Babluani (Eka) und Mariam Bokeria (Natja) wurden in der Schule gecastet. Sie sind faszinierend im Zusammenspiel, aber auch in ihren Einzelszenen. Der rumänische Kameramann Oleg Mutu hat daran einen hohen Anteil. Nana Ekvtimishvili stammt aus Georgien und hat an der HFF ‚Konrad Wolf’ in Potsdam studiert, Simon Groß ist Berliner und hat die HFF München absolviert. Ich hoffe, sie können weitere Filme machen. Mehr zur DVD: 7014/Die+langen+hellen+Tage
08. Mai 2015
Das Ende des Krieges – die Befreiung
 Das Buch „1945. Ikonen eines Jahres“ erzählt die Geschichte der letzten Kriegs-monate in Europa und Deutschland, der Momente der Befreiung und ersten Orientierung in 108 Photo-graphien, von denen ich viele kenne, die aber in der chronolo-gischen Folge und im komprimierten Zusammenhang mich tief berührt haben. Ich war damals sechs Jahre alt, lebte mit meiner Mutter und meiner älteren Schwester in der Evakuierung in einem Dorf in Anhalt. Im April 1945 hatten wir dort einen Tieffliegerangriff überlebt, den ich nie vergessen werde. Im Oktober kehrten wir nach Berlin zurück, im Dezember kam mein Vater aus der Kriegsgefangenschaft heim. Das geschah alles vor 70 Jahren. Aber ich habe tiefe Erinnerungen an diese Zeit. Wenn ich mir jetzt die Photographien anschaue, sehe ich Konzentrationslager, Leichen, zerstörte Städte, Soldaten, Gewalt, die damals mächtigen Politiker und die Folgen der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, aber ich sehe auch: ein kleines Mädchen, das Brennholz sammelt in den Trümmern des zerstörten München (Foto: Herbert List), befreite sowjetische Zwangsarbeiter in einem Zug vor der Rückkehr in die Heimat (Foto: Henri Cartier-Bresson), Frauen und Kinder bei der Trümmerräumung in Berlin (Foto: Georgi Petrussow), Jungen mit Schulranzen im Sommer 1945 in Berlin (Foto: Robert Capa), einen Marinesoldaten, der am V-J Day in New York ein weiß gekleidetes Mädchen küsst (Foto: Alfred Eisenstaedt). Das sind Hoffnungsfotos. Und viele Hoffnungen haben sich erfüllt, auch für mich persönlich. Dies sind Gedanken und Gefühle am 8. Mai im Zusammenhang mit einem Buch, das Lothar Schirmer herausgegeben hat. Ihm sei dafür gedankt. Mit einem Einführungstext des Historikers Norbert Frei. Coverfotos: Hubert Strickland, der Fahrer des Fotografen Robert Capa, auf der Ehrentribüne des Nürnberger Reichsparteitagsgeländes beim ironischen Hitlergruß (oben), Sowjetsoldaten hissen am 2. Mai die Sowjetfahne auf dem Dach des Reichstags in Berlin (Foto: Jewgeni Chaldej). Mehr zum Buch: Ikonen_1945.pdf
Das Buch „1945. Ikonen eines Jahres“ erzählt die Geschichte der letzten Kriegs-monate in Europa und Deutschland, der Momente der Befreiung und ersten Orientierung in 108 Photo-graphien, von denen ich viele kenne, die aber in der chronolo-gischen Folge und im komprimierten Zusammenhang mich tief berührt haben. Ich war damals sechs Jahre alt, lebte mit meiner Mutter und meiner älteren Schwester in der Evakuierung in einem Dorf in Anhalt. Im April 1945 hatten wir dort einen Tieffliegerangriff überlebt, den ich nie vergessen werde. Im Oktober kehrten wir nach Berlin zurück, im Dezember kam mein Vater aus der Kriegsgefangenschaft heim. Das geschah alles vor 70 Jahren. Aber ich habe tiefe Erinnerungen an diese Zeit. Wenn ich mir jetzt die Photographien anschaue, sehe ich Konzentrationslager, Leichen, zerstörte Städte, Soldaten, Gewalt, die damals mächtigen Politiker und die Folgen der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, aber ich sehe auch: ein kleines Mädchen, das Brennholz sammelt in den Trümmern des zerstörten München (Foto: Herbert List), befreite sowjetische Zwangsarbeiter in einem Zug vor der Rückkehr in die Heimat (Foto: Henri Cartier-Bresson), Frauen und Kinder bei der Trümmerräumung in Berlin (Foto: Georgi Petrussow), Jungen mit Schulranzen im Sommer 1945 in Berlin (Foto: Robert Capa), einen Marinesoldaten, der am V-J Day in New York ein weiß gekleidetes Mädchen küsst (Foto: Alfred Eisenstaedt). Das sind Hoffnungsfotos. Und viele Hoffnungen haben sich erfüllt, auch für mich persönlich. Dies sind Gedanken und Gefühle am 8. Mai im Zusammenhang mit einem Buch, das Lothar Schirmer herausgegeben hat. Ihm sei dafür gedankt. Mit einem Einführungstext des Historikers Norbert Frei. Coverfotos: Hubert Strickland, der Fahrer des Fotografen Robert Capa, auf der Ehrentribüne des Nürnberger Reichsparteitagsgeländes beim ironischen Hitlergruß (oben), Sowjetsoldaten hissen am 2. Mai die Sowjetfahne auf dem Dach des Reichstags in Berlin (Foto: Jewgeni Chaldej). Mehr zum Buch: Ikonen_1945.pdf
07. Mai 2015
Western global
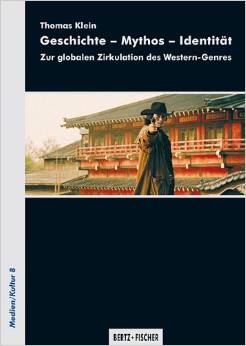 Western – das ist das amerikanische Filmgenre schlechthin, auch wenn er in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat. Der erste Western war THE GREAT TRAIN ROBBERY (1903). Und die schönsten Western sind für mich die Filme von John Ford. Seit den 1960er Jahren gibt es den Italowestern. Und Thomas Klein durfte, finanziert von der Deutschen Forschungs-gemeinschaft, die Globalisierung des Western auch in anderen Ländern untersuchen. Sein Länderfokus waren vor allem: Mexiko, Australien, Brasilien, Japan. Im mexikanischen Kino sind es die Revolutionsfilme, im australischen Kino die Bushranger-Filme, im brasilianischen Kino die Cangaceiro-Filme, im japanischen Kino die Samurai-Filme, die eine Affinität zum Western haben. Zunächst beschäftigt sich Klein mit den Western-Stereotypen im kulturellen Kontext. Dann untersucht er die Folgen fürs Genrekino im Zusammenhang mit dem Postkolonialismus. Eine dominierende Rolle spielt in diesem Genre die Landschaft. Eine eigene Kategorie sind die Standardsituationen. Ausführlich widmet sich der Autor den nationalen Western-Diskursen in Australien und Lateinamerika. Den größten Raum nehmen aber die bösen Protagonisten ein, die Outlaws und Sozialbanditen. In Australien sind es die „Wild Colonial Boys“, in Mexiko die „Charro-Outlaws“, in Brasilien die „Cangaceiros“, in Argentinien die „Gaucho Outlaws“, in Japan „Ronin“ und „Yakuza“. In diesem Kapitel werden viele Filmbeispiele genannt, die sich auch in den (technisch hervorragenden) Abbildungen wiederfinden. Das Literaturverzeichnis ist umfangreich. Eine beispielhafte Genreuntersuchung. Coverfoto: SUKIYAKI WESTERN DJANGO (2007). Mehr zum Buch: 42&products_id=427
Western – das ist das amerikanische Filmgenre schlechthin, auch wenn er in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat. Der erste Western war THE GREAT TRAIN ROBBERY (1903). Und die schönsten Western sind für mich die Filme von John Ford. Seit den 1960er Jahren gibt es den Italowestern. Und Thomas Klein durfte, finanziert von der Deutschen Forschungs-gemeinschaft, die Globalisierung des Western auch in anderen Ländern untersuchen. Sein Länderfokus waren vor allem: Mexiko, Australien, Brasilien, Japan. Im mexikanischen Kino sind es die Revolutionsfilme, im australischen Kino die Bushranger-Filme, im brasilianischen Kino die Cangaceiro-Filme, im japanischen Kino die Samurai-Filme, die eine Affinität zum Western haben. Zunächst beschäftigt sich Klein mit den Western-Stereotypen im kulturellen Kontext. Dann untersucht er die Folgen fürs Genrekino im Zusammenhang mit dem Postkolonialismus. Eine dominierende Rolle spielt in diesem Genre die Landschaft. Eine eigene Kategorie sind die Standardsituationen. Ausführlich widmet sich der Autor den nationalen Western-Diskursen in Australien und Lateinamerika. Den größten Raum nehmen aber die bösen Protagonisten ein, die Outlaws und Sozialbanditen. In Australien sind es die „Wild Colonial Boys“, in Mexiko die „Charro-Outlaws“, in Brasilien die „Cangaceiros“, in Argentinien die „Gaucho Outlaws“, in Japan „Ronin“ und „Yakuza“. In diesem Kapitel werden viele Filmbeispiele genannt, die sich auch in den (technisch hervorragenden) Abbildungen wiederfinden. Das Literaturverzeichnis ist umfangreich. Eine beispielhafte Genreuntersuchung. Coverfoto: SUKIYAKI WESTERN DJANGO (2007). Mehr zum Buch: 42&products_id=427
04. Mai 2015
Oskar Roehler: ein Buch und ein Film
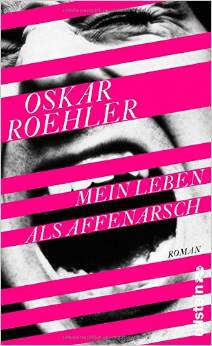 Zeit: die 1980er Jahre. Ort: Westberlin. Oskar Roehler erzählt in seinem Buch „Mein Leben als Affenarsch“ und in seinem Film TOD DEN HIPPIES!! ES LEBE DER PUNK die über weite Strecken identische Geschichte seines Alter Ego Robert, der vom Souterrain in Wedding aufsteigt in eine Altbauetage in Schöneberg, der als Zwanzigjähriger in Berlin beginnt, seine Identität zu suchen, als Putzmann in einer Peepshow jobbt, eigentlich ein Dichter werden will, seine ersten Drogenerfahrungen macht, sich mit einer Stripperin zusammentut, die aus Wuppertal stammt und eher eine Kleinbürgerin ist. Roberts Kleidung ist ein alter Wehrmachtsmantel, er trägt eine Irokesenfrisur, er unternimmt Gewaltmärsche durch die Stadt, er lässt sich in die Paris Bar und ins „Risiko“ mitnehmen, er hört Blixa Bargeld und die „Einstürzenden Neubauten“; er ist eine literarische Figur und eine Filmfigur, und wir stellen uns vor, dass es Oskar Roehler ist, der sich von seiner tablettensüchtigen Mutter und seinem alkoholkranken Vater emanzipiert und in einer Mischung aus Autobiografie und Fiktion Erinnerungsarbeit leistet. Das Buch ist ein „Ich“-Roman, im Film spielt Tom Schilling den Robert, Hannelore Hoger die Mutter, Samuel Finzi den Vater, Emilia Schüle die Stripperin, die im Buch Nina und im Film Sanja heißt, Alexander Scheer den Blixa Bargeld. Das zeitgleiche Erscheinen von Buch und Film macht deutlich, dass Oskar Roehler als Autor und als Filmemacher in gleicher Weise begabt ist. Er wird oft unterschätzt. Vielleicht, weil er auch Grenzen verletzten kann. Wir können noch viel von ihm erwarten. Mehr zum Buch: 9783550080425.html
Zeit: die 1980er Jahre. Ort: Westberlin. Oskar Roehler erzählt in seinem Buch „Mein Leben als Affenarsch“ und in seinem Film TOD DEN HIPPIES!! ES LEBE DER PUNK die über weite Strecken identische Geschichte seines Alter Ego Robert, der vom Souterrain in Wedding aufsteigt in eine Altbauetage in Schöneberg, der als Zwanzigjähriger in Berlin beginnt, seine Identität zu suchen, als Putzmann in einer Peepshow jobbt, eigentlich ein Dichter werden will, seine ersten Drogenerfahrungen macht, sich mit einer Stripperin zusammentut, die aus Wuppertal stammt und eher eine Kleinbürgerin ist. Roberts Kleidung ist ein alter Wehrmachtsmantel, er trägt eine Irokesenfrisur, er unternimmt Gewaltmärsche durch die Stadt, er lässt sich in die Paris Bar und ins „Risiko“ mitnehmen, er hört Blixa Bargeld und die „Einstürzenden Neubauten“; er ist eine literarische Figur und eine Filmfigur, und wir stellen uns vor, dass es Oskar Roehler ist, der sich von seiner tablettensüchtigen Mutter und seinem alkoholkranken Vater emanzipiert und in einer Mischung aus Autobiografie und Fiktion Erinnerungsarbeit leistet. Das Buch ist ein „Ich“-Roman, im Film spielt Tom Schilling den Robert, Hannelore Hoger die Mutter, Samuel Finzi den Vater, Emilia Schüle die Stripperin, die im Buch Nina und im Film Sanja heißt, Alexander Scheer den Blixa Bargeld. Das zeitgleiche Erscheinen von Buch und Film macht deutlich, dass Oskar Roehler als Autor und als Filmemacher in gleicher Weise begabt ist. Er wird oft unterschätzt. Vielleicht, weil er auch Grenzen verletzten kann. Wir können noch viel von ihm erwarten. Mehr zum Buch: 9783550080425.html
03. Mai 2015
DER SANFTE LAUF (1966/67)
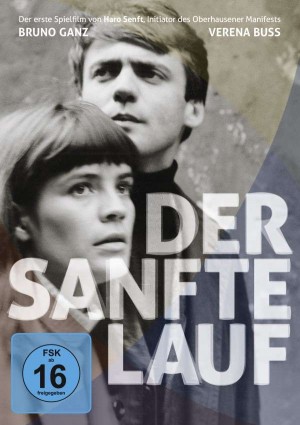 Wunderbar: das Gesicht, die Körpersprache, die Stimme des 25jährigen Bruno Ganz. Dies war der erste Film des Schweizer Schauspielers in Deutschland. Er spielt den jungen Angestellten Bernhard Krahl in der Versandabteilung einer Elektrofirma, verliebt sich in Johanna, die Tochter eines Bauunternehmers (sympathisch gespielt von Verena Buss), macht Karriere in seiner Firma, unternimmt mit Johanna eine Reise in seine Geburtsstadt Prag, weil er mehr über seine Vergangenheit erfahren will, und wird am Ende des Films mit der Nachricht konfrontiert, dass er seinen Aufstieg in der Firma nicht seinen Leistungen, sondern der Fürsprache von Johannas Vater zu verdanken hat. Es bleibt offen, wie er mit dieser Nachricht umgeht. DER SANFTE LAUF war der erste Spielfilm von Haro Senft (*1928), einem der Initiatoren des „Oberhausener Manifests“, wurde vom gerade gegründeten „Kuratorium junger deutscher Film“ gefördert, war damals im Kino nicht sehr erfolgreich und ist nur Filmhistorikern in guter Erinnerung. Es ist ein sehr sensibler Film, an der Kamera stand der Tscheche Jan Čuřík, und natürlich interessieren wir uns heute vor allem für Bruno Ganz, der aus der Figur des Bernhard einen komplexen Charakter macht. Haro Senft ist später vor allem durch seine Kinderfilme (EIN TAG MIT DEM WIND, 1978) bekannt geworden. Die DVD enthält als Bonusmaterial sieben Kurzfilme von Senft, darunter sind VON 6 BIS 6 (1959), KAHL (1961) und AUTO AUTO (1964). Wilhelm Roth hat für das Booklet einen schönen Text über Leben und Werk von Haro Senft geschrieben, über den 2013 im Übrigen eine sehr fundierte Biografie von Michaela S. Ast erschienen ist (09/haro-senft/ ). Mehr zur DVD bei Absolut Medien: film/3904/Der+sanfte+Lauf
Wunderbar: das Gesicht, die Körpersprache, die Stimme des 25jährigen Bruno Ganz. Dies war der erste Film des Schweizer Schauspielers in Deutschland. Er spielt den jungen Angestellten Bernhard Krahl in der Versandabteilung einer Elektrofirma, verliebt sich in Johanna, die Tochter eines Bauunternehmers (sympathisch gespielt von Verena Buss), macht Karriere in seiner Firma, unternimmt mit Johanna eine Reise in seine Geburtsstadt Prag, weil er mehr über seine Vergangenheit erfahren will, und wird am Ende des Films mit der Nachricht konfrontiert, dass er seinen Aufstieg in der Firma nicht seinen Leistungen, sondern der Fürsprache von Johannas Vater zu verdanken hat. Es bleibt offen, wie er mit dieser Nachricht umgeht. DER SANFTE LAUF war der erste Spielfilm von Haro Senft (*1928), einem der Initiatoren des „Oberhausener Manifests“, wurde vom gerade gegründeten „Kuratorium junger deutscher Film“ gefördert, war damals im Kino nicht sehr erfolgreich und ist nur Filmhistorikern in guter Erinnerung. Es ist ein sehr sensibler Film, an der Kamera stand der Tscheche Jan Čuřík, und natürlich interessieren wir uns heute vor allem für Bruno Ganz, der aus der Figur des Bernhard einen komplexen Charakter macht. Haro Senft ist später vor allem durch seine Kinderfilme (EIN TAG MIT DEM WIND, 1978) bekannt geworden. Die DVD enthält als Bonusmaterial sieben Kurzfilme von Senft, darunter sind VON 6 BIS 6 (1959), KAHL (1961) und AUTO AUTO (1964). Wilhelm Roth hat für das Booklet einen schönen Text über Leben und Werk von Haro Senft geschrieben, über den 2013 im Übrigen eine sehr fundierte Biografie von Michaela S. Ast erschienen ist (09/haro-senft/ ). Mehr zur DVD bei Absolut Medien: film/3904/Der+sanfte+Lauf
02. Mai 2015
DIE SCHAUSPIELERIN
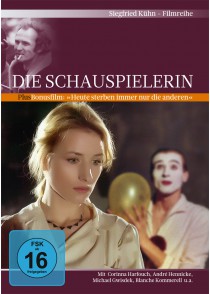 Noch eine neue DVD mit zwei DEFA-Filmen von Siegfried Kühn: Der Hauptfilm, DIE SCHAUSPIELERIN (1988), erzählt die melodramatische Geschichte eines Identitäts-wechsels in der frühen Nazizeit. Maria Rheine (gespielt von Corinna Harfouch) hat ein Enga-gement am Theater in Magdeburg. Sie liebt ihren Kollegen Mark Löwenthal (André Hennicke). Ihre beruflichen Wege trennen sich, Maria folgt einem Angebot aus München und wird dort zum Star, Mark geht zum jüdischen Theater in Berlin. Wir erleben, wie Mark einmal nach München fährt, Maria dort als Johanna auf der Bühne sieht, aber einer Begegnung ausweicht, und wie Maria Mark als Pantomimen im jüdischen Theater aus den Kulissen beobachtet. Trotz großer Erfolge in München ändert Maria ihren Namen in Manja Löwenthal, färbt ihr blondes Haar schwarz und findet einen Platz im Ensemble des jüdischen Theaters. Am Ende wird ihr Identitätswechsel durch eine Intrige an die Gestapo verraten. Der Film nutzt die Bühnenwelt – Proben, Aufführungen, Kostümwechsel in den Garderoben – für ein Spiel mit vielen Realitäten, politischen, kulturellen, psychologischen, geschlechtsspezifischen. Es gibt ungewöhnlich viele Spiegelszenen, die vor allem von Corinna Harfouch für die Zwiesprache mit sich selbst und mit den von ihr verkörperten Rollen genutzt werden. Sie erweist sich wieder als herausragende Darstellerin, die eine größere Wirkung entfaltet als ihre männlichen Partner (Hennicke und, als Kollege in München, Michael Gwisdek). Die Kameraführung von Peter Ziesche ist beeindruckend sowohl in den Großaufnahmen als auch in den Raumtotalen. Auch die Maskenbildner haben hervorragend gearbeitet. Als „Bonusfilm“ enthält die DVD Kühns späten Film HEUTE STERBEN IMMER NUR DIE ANDERN. Auch hier sind Schauspielerinnen die Hauptpersonen. Sie heißen Hanna, Maria und Lisa, treffen sich nach langer Zeit wieder und müssen sich damit auseinandersetzen, dass Maria an Krebs erkrankt ist und nicht mehr lange leben wird. So thematisiert Kühn das Thema Sterbehilfe. Es gibt viele symbolische Bildelemente, und die ständigen Erinnerungen an eine Gondelfahrt in Venedig gehen einem auf die Nerven, aber Katrin Saß (Hanna), Ulrike Krumbiegel (Lisa) und vor allem Gudrun Ritter (Maria) sind starke Darstellerinnen. – Eine dritte DVD mit Filmen von Siegfried Kühn ist angekündigt. Mehr zur DVD: die-schauspielerin-heute-sterben-immer-nur-die-andern-sparkauf.html
Noch eine neue DVD mit zwei DEFA-Filmen von Siegfried Kühn: Der Hauptfilm, DIE SCHAUSPIELERIN (1988), erzählt die melodramatische Geschichte eines Identitäts-wechsels in der frühen Nazizeit. Maria Rheine (gespielt von Corinna Harfouch) hat ein Enga-gement am Theater in Magdeburg. Sie liebt ihren Kollegen Mark Löwenthal (André Hennicke). Ihre beruflichen Wege trennen sich, Maria folgt einem Angebot aus München und wird dort zum Star, Mark geht zum jüdischen Theater in Berlin. Wir erleben, wie Mark einmal nach München fährt, Maria dort als Johanna auf der Bühne sieht, aber einer Begegnung ausweicht, und wie Maria Mark als Pantomimen im jüdischen Theater aus den Kulissen beobachtet. Trotz großer Erfolge in München ändert Maria ihren Namen in Manja Löwenthal, färbt ihr blondes Haar schwarz und findet einen Platz im Ensemble des jüdischen Theaters. Am Ende wird ihr Identitätswechsel durch eine Intrige an die Gestapo verraten. Der Film nutzt die Bühnenwelt – Proben, Aufführungen, Kostümwechsel in den Garderoben – für ein Spiel mit vielen Realitäten, politischen, kulturellen, psychologischen, geschlechtsspezifischen. Es gibt ungewöhnlich viele Spiegelszenen, die vor allem von Corinna Harfouch für die Zwiesprache mit sich selbst und mit den von ihr verkörperten Rollen genutzt werden. Sie erweist sich wieder als herausragende Darstellerin, die eine größere Wirkung entfaltet als ihre männlichen Partner (Hennicke und, als Kollege in München, Michael Gwisdek). Die Kameraführung von Peter Ziesche ist beeindruckend sowohl in den Großaufnahmen als auch in den Raumtotalen. Auch die Maskenbildner haben hervorragend gearbeitet. Als „Bonusfilm“ enthält die DVD Kühns späten Film HEUTE STERBEN IMMER NUR DIE ANDERN. Auch hier sind Schauspielerinnen die Hauptpersonen. Sie heißen Hanna, Maria und Lisa, treffen sich nach langer Zeit wieder und müssen sich damit auseinandersetzen, dass Maria an Krebs erkrankt ist und nicht mehr lange leben wird. So thematisiert Kühn das Thema Sterbehilfe. Es gibt viele symbolische Bildelemente, und die ständigen Erinnerungen an eine Gondelfahrt in Venedig gehen einem auf die Nerven, aber Katrin Saß (Hanna), Ulrike Krumbiegel (Lisa) und vor allem Gudrun Ritter (Maria) sind starke Darstellerinnen. – Eine dritte DVD mit Filmen von Siegfried Kühn ist angekündigt. Mehr zur DVD: die-schauspielerin-heute-sterben-immer-nur-die-andern-sparkauf.html
01. Mai 2015
Dominik Graf
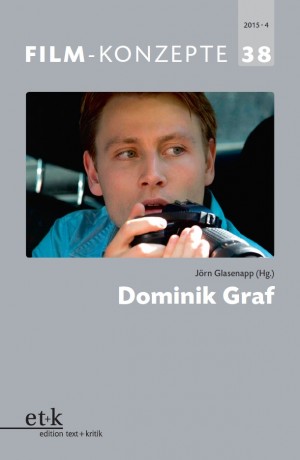 Dies ist bereits die Nummer 38 der Film-Konzepte. Sie ist dem Regisseur Dominik Graf gewidmet. Die sieben Beiträge dieses Heftes gehen auf ein Kollo-quium zurück, das im November 2014 an der Otto-Friedrich-Universi-tät in Bamberg statt-gefunden hat. Felix Lenz sieht in seinem Referat die FAHNDER-Krimis als Skizzen zu späteren Werken. Judith Ellenbürger beschäftigt sich mit der „Körper-lichkeit des Geldes“ bei Graf. Jörn Glasenapp, diesmal der Herausgeber des Heftes, analysiert die Hauptpersonen im Drama aus dem Rotlichtmilieu, HOTTE IM PARADIES (2002). Kathrin Rothemund macht sich Gedanken über die Elemente der Serialität in Grafs Miniserie IM ANGESICHT DES VERBRECHENS (2010). Lisa Gotto untersucht in ihrem sehr reflektierten Beitrag die filmischen Mittel in dem Essayfilm über den Schauspieler Robert Graf, DAS WISPERN IM BERG DER DINGE (1997), den Dominik zusammen mit Michael Althen realisiert hat und der sich der Autorin als „eine vielgestaltige Collage von Kriegs- und Nachkriegsgenerationen, Film- und Fernsehinstitutionen, gesellschaftlichen Verhältnissen und medialen Verständnissen“ darstellt. Auch die beiden folgenden Texte widmen sich Essayfilmen: bei Florian Lehmann geht es um „Topographie, Typologie, Potentialis“ in MÜNCHEN – GEHEIMNISSE EINER STADT (2000), ebenfalls gemeinsam von Graf und Michael Althen verantwortet, bei Oliver Fahle um „Analyse, Geschichte und Poetik des Fernsehen“ in ES WERDE STADT! (2014), dem Film zum 50jährigen Bestehen des Grimme-Preises, den Graf zusammen mit Martin Farkas gedreht hat. Den Abschluss des Heftes bildet ein „Logbucheintrag“ von Dominik aus dem Dezember 2014, als er zusammen mit Tobias Streck den Film über Michael Althen montiert hat, den ich natürlich sehr berührend finde. Coverfoto: IM ANGESICHT DES VERBRECHENS. Mehr zum Heft: 9783869164021#.VTvmnRyWFgs
Dies ist bereits die Nummer 38 der Film-Konzepte. Sie ist dem Regisseur Dominik Graf gewidmet. Die sieben Beiträge dieses Heftes gehen auf ein Kollo-quium zurück, das im November 2014 an der Otto-Friedrich-Universi-tät in Bamberg statt-gefunden hat. Felix Lenz sieht in seinem Referat die FAHNDER-Krimis als Skizzen zu späteren Werken. Judith Ellenbürger beschäftigt sich mit der „Körper-lichkeit des Geldes“ bei Graf. Jörn Glasenapp, diesmal der Herausgeber des Heftes, analysiert die Hauptpersonen im Drama aus dem Rotlichtmilieu, HOTTE IM PARADIES (2002). Kathrin Rothemund macht sich Gedanken über die Elemente der Serialität in Grafs Miniserie IM ANGESICHT DES VERBRECHENS (2010). Lisa Gotto untersucht in ihrem sehr reflektierten Beitrag die filmischen Mittel in dem Essayfilm über den Schauspieler Robert Graf, DAS WISPERN IM BERG DER DINGE (1997), den Dominik zusammen mit Michael Althen realisiert hat und der sich der Autorin als „eine vielgestaltige Collage von Kriegs- und Nachkriegsgenerationen, Film- und Fernsehinstitutionen, gesellschaftlichen Verhältnissen und medialen Verständnissen“ darstellt. Auch die beiden folgenden Texte widmen sich Essayfilmen: bei Florian Lehmann geht es um „Topographie, Typologie, Potentialis“ in MÜNCHEN – GEHEIMNISSE EINER STADT (2000), ebenfalls gemeinsam von Graf und Michael Althen verantwortet, bei Oliver Fahle um „Analyse, Geschichte und Poetik des Fernsehen“ in ES WERDE STADT! (2014), dem Film zum 50jährigen Bestehen des Grimme-Preises, den Graf zusammen mit Martin Farkas gedreht hat. Den Abschluss des Heftes bildet ein „Logbucheintrag“ von Dominik aus dem Dezember 2014, als er zusammen mit Tobias Streck den Film über Michael Althen montiert hat, den ich natürlich sehr berührend finde. Coverfoto: IM ANGESICHT DES VERBRECHENS. Mehr zum Heft: 9783869164021#.VTvmnRyWFgs
30. April 2015
Totentanz im Film
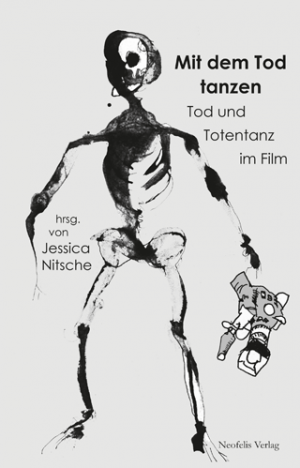 Zwölf lesenswerte Texte zu einem interessanten Filmmotiv, beginnend mit den Todesbildern in den Stummfilmen von Fritz Lang (Autorin: Silke Hoklas), speziell in METROPOLIS (1926). Susanne Kaul forscht über den Totentanz im Zeichentrick und konkretisiert dies in der Filmkomik von Walt Disneys THE SKELETON DANCE (1929), einem 5 1/2-minütigen Kurzfilm. Viola Rühse verbindet in ihrem Text Sergej Eisensteins danse macabre in QUE VIVA MEXICO! (1931) mit der Rezeption in den filmtheoretischen Entwürfen von Siegfried Kracauer. Anke Zechner referiert über den Totentanz im Brautkleid in Pier Paolo Pasolinis MEDEA (1969). Felix Lenz beschäftigt sich mit den amerikanischen Totentänzen in Terrence Malicks BADLANDS (1973) und THE TREE OF LIFE (2011). Jean-Pierre Palmier schreibt über Choreografien des Todes in den Filmen von Quentin Tarantino. Im Text der Herausgeberin Jessica Nitsche geht es um die Konstellation von Tod, Fotografie und Film in PALERMO SHHOOTING (2007) von Wim Wenders. Bernd Schneid reflektiert über das „Spiel im Spiel“ vom Tod in Lars von Triers Film MELANCHOLIA (2011). Daniel S. Ribeiro thematisiert den Tod im zeitgenössischen Dokumentarfilm. In den abschließenden drei Essays wechseln wir in den Bereich der Videokunst. Tim Pickartz untersucht „Choreografien des Todes in bewegten und bewegenden Bildern zeitgenössischer Videokunst“. Mariaelisa Dimino fokussiert ihren Text auf die Videokunst von Alessando Amaducci. Und Andreas Becker formuliert zum Abschluss „Notizen zum Bon Odori“. Mit Bibliografie und Filmografie. 53 Abbildungen in sehr guter Qualität. Mehr zum Buch: mit-dem-tod-tanzen/
Zwölf lesenswerte Texte zu einem interessanten Filmmotiv, beginnend mit den Todesbildern in den Stummfilmen von Fritz Lang (Autorin: Silke Hoklas), speziell in METROPOLIS (1926). Susanne Kaul forscht über den Totentanz im Zeichentrick und konkretisiert dies in der Filmkomik von Walt Disneys THE SKELETON DANCE (1929), einem 5 1/2-minütigen Kurzfilm. Viola Rühse verbindet in ihrem Text Sergej Eisensteins danse macabre in QUE VIVA MEXICO! (1931) mit der Rezeption in den filmtheoretischen Entwürfen von Siegfried Kracauer. Anke Zechner referiert über den Totentanz im Brautkleid in Pier Paolo Pasolinis MEDEA (1969). Felix Lenz beschäftigt sich mit den amerikanischen Totentänzen in Terrence Malicks BADLANDS (1973) und THE TREE OF LIFE (2011). Jean-Pierre Palmier schreibt über Choreografien des Todes in den Filmen von Quentin Tarantino. Im Text der Herausgeberin Jessica Nitsche geht es um die Konstellation von Tod, Fotografie und Film in PALERMO SHHOOTING (2007) von Wim Wenders. Bernd Schneid reflektiert über das „Spiel im Spiel“ vom Tod in Lars von Triers Film MELANCHOLIA (2011). Daniel S. Ribeiro thematisiert den Tod im zeitgenössischen Dokumentarfilm. In den abschließenden drei Essays wechseln wir in den Bereich der Videokunst. Tim Pickartz untersucht „Choreografien des Todes in bewegten und bewegenden Bildern zeitgenössischer Videokunst“. Mariaelisa Dimino fokussiert ihren Text auf die Videokunst von Alessando Amaducci. Und Andreas Becker formuliert zum Abschluss „Notizen zum Bon Odori“. Mit Bibliografie und Filmografie. 53 Abbildungen in sehr guter Qualität. Mehr zum Buch: mit-dem-tod-tanzen/
29. April 2015
Authentizität in der Filmbiografie
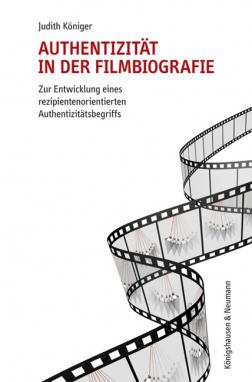 Das „Biopic“ – gemeint sind damit die verfilmten Lebens-geschichten von Künstle-rinnen und Künstlern, Wissenschaftlern, Politikern oder Königinnen – ist ein beliebtes Genre mit einer großen Tradition. Judith Königer fragt in ihrer Dissertation (Ludwig Maximilian Universität München), wie „authen-tisch“ eine Filmbiographie sein muss, wie viel fiktionale Freiheiten sich ein Biopic leisten kann, um bei den Rezipienten, den Zuschauerinnen und Zuschauern, eine positive Wirkung zu haben. Sie untersucht in diesem Zusammenhang die Faktoren Glaubwürdigkeit, Relevanz, Kontingenz und Wahrscheinlichkeit. Ihre Kapitel heißen „Authentizität und Bild“, „Authentizität und Film“, „Authentizität und Fiktion“, „Authentizität und Rezeption“. Ihre theoretischen Bezugspunkte findet sie u.a. bei Manfred Hattendorf („Dokumentarfilm und Authentizität“, 1994), Eva Hohenberger („Die Wirklichkeit des Films“, 1988), Hans Robert Jauß („Der Gebrauch der Fiktion in der Anschauung und Darstellung von Geschichte“, 1982), Klaus Sachs-Hombach (diverse Texte) und Henry M. Taylor („Rolle des Lebens. Die Filmbiographie als narratives System“, 2002). Drei gut ausgewählte Filmbeispiele nutzt die Autorin, um ihre Thesen zur Authentizität konkret zu überprüfen: POLLOCK (USA 2000) von Ed Harris, der 15 Jahre aus dem Leben des amerikanischen Malers Jackson Pollock erzählt, LA VIE EN ROSE (2007) von Olivier Dahan, die Lebensgeschichte der französischen Sängerin Edith Piaf, und CÉLESTE (1981) von Percy Adlon, eine Filmbiografie über Marcel Proust, erzählt aus der Perspektive seiner Haushälterin Céleste Albaret, die den Romancier in den letzten neun Jahren seines Lebens betreut hat. Die Filmanalysen sind beeindruckend und verleihen dem theoretischen Konstrukt einen überzeugenden Zusammenhang. Die wenigen, kleinen Abbildungen in akzeptabler Qualität sind hilfreich. Mehr zum Buch: Bd–825.html
Das „Biopic“ – gemeint sind damit die verfilmten Lebens-geschichten von Künstle-rinnen und Künstlern, Wissenschaftlern, Politikern oder Königinnen – ist ein beliebtes Genre mit einer großen Tradition. Judith Königer fragt in ihrer Dissertation (Ludwig Maximilian Universität München), wie „authen-tisch“ eine Filmbiographie sein muss, wie viel fiktionale Freiheiten sich ein Biopic leisten kann, um bei den Rezipienten, den Zuschauerinnen und Zuschauern, eine positive Wirkung zu haben. Sie untersucht in diesem Zusammenhang die Faktoren Glaubwürdigkeit, Relevanz, Kontingenz und Wahrscheinlichkeit. Ihre Kapitel heißen „Authentizität und Bild“, „Authentizität und Film“, „Authentizität und Fiktion“, „Authentizität und Rezeption“. Ihre theoretischen Bezugspunkte findet sie u.a. bei Manfred Hattendorf („Dokumentarfilm und Authentizität“, 1994), Eva Hohenberger („Die Wirklichkeit des Films“, 1988), Hans Robert Jauß („Der Gebrauch der Fiktion in der Anschauung und Darstellung von Geschichte“, 1982), Klaus Sachs-Hombach (diverse Texte) und Henry M. Taylor („Rolle des Lebens. Die Filmbiographie als narratives System“, 2002). Drei gut ausgewählte Filmbeispiele nutzt die Autorin, um ihre Thesen zur Authentizität konkret zu überprüfen: POLLOCK (USA 2000) von Ed Harris, der 15 Jahre aus dem Leben des amerikanischen Malers Jackson Pollock erzählt, LA VIE EN ROSE (2007) von Olivier Dahan, die Lebensgeschichte der französischen Sängerin Edith Piaf, und CÉLESTE (1981) von Percy Adlon, eine Filmbiografie über Marcel Proust, erzählt aus der Perspektive seiner Haushälterin Céleste Albaret, die den Romancier in den letzten neun Jahren seines Lebens betreut hat. Die Filmanalysen sind beeindruckend und verleihen dem theoretischen Konstrukt einen überzeugenden Zusammenhang. Die wenigen, kleinen Abbildungen in akzeptabler Qualität sind hilfreich. Mehr zum Buch: Bd–825.html