26. Mai 2019
DIE 3-GROSCHEN-OPER (1931)
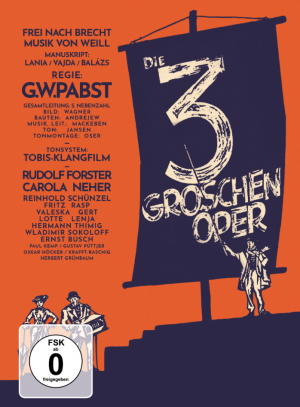 Der Film, eine Nero-Produktion für Tobis-Klangfilm und Warner Brothers, wurde 1930 realisiert. Er basierte auf dem sehr erfolg-reichen Bühnenstück von Bert Brecht und Kurt Weill und war während der Dreharbeiten von heftigen juristischen Auseinan-dersetzungen begleitet, weil Brecht von der Mitarbeit ausge-schlossen wurde, nachdem er für die Filmfassung die anti-kapitalistischen Aspekte verschärft hatte. Den „Dreigro-schenprozess“ verlor Brecht in erster Instanz, dann einigten sich die Parteien auf einen Vergleich. Als Regisseur trug G. W. Pabst die Verantwortung, für das Drehbuch zeichneten Leo Lania, Ladislaus Vajda und Béla Balász, hinter der Kamera stand Fritz Arno Wagner. Die Handlung spielt im Londoner Unterweltmilieu, Hauptfiguren sind der Bandenchef Mackie Messer, der Bettlerkönig Peachum, seine Tochter Polly, der Polizeichef Tiger-Brown, die Hure Jenny. Die Spontanhochzeit von Mackie Messer und Jenny führt zu Konflikten mit Peachum, der seine Tochter nicht freigeben will. Vor allem die Besetzung ist herausragend: Rudolf Forster als Mackie Messer, Carola Neher als Polly, Reinhold Schünzel als Tiger-Brown, Fritz Rasp als Peachum, Valeska Gert als seine Frau, Lotte Lenya als Jenny, Ernst Busch als Moritatensänger. Bei atlas film sind jetzt DVD und Blu-ray des Films erschienen, mit einem sehr informativen Booklet (faksimilierter Illustrierter Film-Kurier, Text von Martin Koerber zur Geschichte der Verfilmung, Pressestimmen – u.a. von Siegfried Kracauer – zum Dreigroschenprozess und zum Film). Zu den Extras gehört eine 30-Minuten-Dokumentation von Robert Fischer: FILMHELD MACKIE MESSER mit einem Interview mit Michael Pabst (2008). Mehr zur DVD: dvd-blu-ray
Der Film, eine Nero-Produktion für Tobis-Klangfilm und Warner Brothers, wurde 1930 realisiert. Er basierte auf dem sehr erfolg-reichen Bühnenstück von Bert Brecht und Kurt Weill und war während der Dreharbeiten von heftigen juristischen Auseinan-dersetzungen begleitet, weil Brecht von der Mitarbeit ausge-schlossen wurde, nachdem er für die Filmfassung die anti-kapitalistischen Aspekte verschärft hatte. Den „Dreigro-schenprozess“ verlor Brecht in erster Instanz, dann einigten sich die Parteien auf einen Vergleich. Als Regisseur trug G. W. Pabst die Verantwortung, für das Drehbuch zeichneten Leo Lania, Ladislaus Vajda und Béla Balász, hinter der Kamera stand Fritz Arno Wagner. Die Handlung spielt im Londoner Unterweltmilieu, Hauptfiguren sind der Bandenchef Mackie Messer, der Bettlerkönig Peachum, seine Tochter Polly, der Polizeichef Tiger-Brown, die Hure Jenny. Die Spontanhochzeit von Mackie Messer und Jenny führt zu Konflikten mit Peachum, der seine Tochter nicht freigeben will. Vor allem die Besetzung ist herausragend: Rudolf Forster als Mackie Messer, Carola Neher als Polly, Reinhold Schünzel als Tiger-Brown, Fritz Rasp als Peachum, Valeska Gert als seine Frau, Lotte Lenya als Jenny, Ernst Busch als Moritatensänger. Bei atlas film sind jetzt DVD und Blu-ray des Films erschienen, mit einem sehr informativen Booklet (faksimilierter Illustrierter Film-Kurier, Text von Martin Koerber zur Geschichte der Verfilmung, Pressestimmen – u.a. von Siegfried Kracauer – zum Dreigroschenprozess und zum Film). Zu den Extras gehört eine 30-Minuten-Dokumentation von Robert Fischer: FILMHELD MACKIE MESSER mit einem Interview mit Michael Pabst (2008). Mehr zur DVD: dvd-blu-ray
25. Mai 2019
WALDHEIMS WALZER (2018)
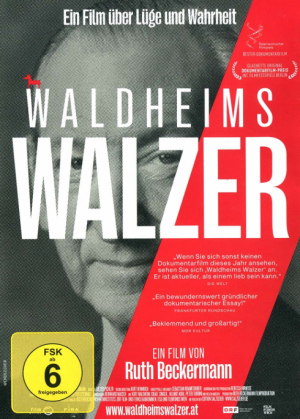 Der Film von Ruth Beckermann war im Forums-Programm der Berlinale 2018 zu sehen und wurde mit dem Glashütte-Preis als bester Dokumentarfilm des Festivals ausgezeichnet. Ich fand ihn hervorragend, weil er eine bildmächtige Erinnerung an die Kandidatur des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kurt Waldheim für das Amt des Bundespräsidenten in Österreich im Jahr 1986 ist. Waldheim war von der ÖVP nominiert worden und musste sich mit Vorwürfen auseinandersetzen, an Kriegsverbrechen der Nazi-Zeit beteiligt gewesen zu sein. Ruth Beckermann hatte sich damals an Protestaktionen gegen Waldheim beteiligt und Videoaufnahmen gemacht. Sie sind Teil des Materials, das sie jetzt zu einem essayistischen Film montiert hat. Zu sehen sind außerdem Fernsehbilder, öffentliche Auftritte, Wahlkampfsprüche. Waldheim siegte damals in einer Stichwahl und war vier Jahre Präsident Österreichs. Es wurde eine schwierige Amtszeit. Beckermanns Film erweist sich als kluge Dokumentation der medialen Prozesse bei einer nationalen Auseinandersetzung. Die aktuelle Situation in Österreich macht den Film zusätzlich spannend. Die DVD des Films ist jetzt bei der Edition Salzgeber erschienen. Mit einem sehr informativen Booklet. Mehr zur DVD: =8-2-fkmrnull
Der Film von Ruth Beckermann war im Forums-Programm der Berlinale 2018 zu sehen und wurde mit dem Glashütte-Preis als bester Dokumentarfilm des Festivals ausgezeichnet. Ich fand ihn hervorragend, weil er eine bildmächtige Erinnerung an die Kandidatur des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kurt Waldheim für das Amt des Bundespräsidenten in Österreich im Jahr 1986 ist. Waldheim war von der ÖVP nominiert worden und musste sich mit Vorwürfen auseinandersetzen, an Kriegsverbrechen der Nazi-Zeit beteiligt gewesen zu sein. Ruth Beckermann hatte sich damals an Protestaktionen gegen Waldheim beteiligt und Videoaufnahmen gemacht. Sie sind Teil des Materials, das sie jetzt zu einem essayistischen Film montiert hat. Zu sehen sind außerdem Fernsehbilder, öffentliche Auftritte, Wahlkampfsprüche. Waldheim siegte damals in einer Stichwahl und war vier Jahre Präsident Österreichs. Es wurde eine schwierige Amtszeit. Beckermanns Film erweist sich als kluge Dokumentation der medialen Prozesse bei einer nationalen Auseinandersetzung. Die aktuelle Situation in Österreich macht den Film zusätzlich spannend. Die DVD des Films ist jetzt bei der Edition Salzgeber erschienen. Mit einem sehr informativen Booklet. Mehr zur DVD: =8-2-fkmrnull
24. Mai 2019
Hat es Spaß gemacht, Mr. Wilder?
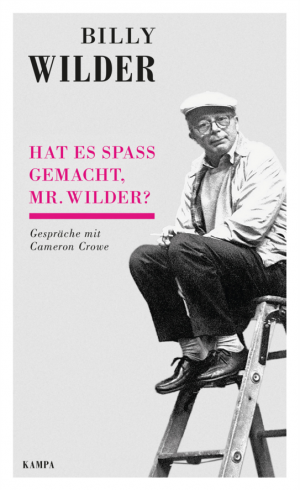 Der Autor und Regisseur Cameron Crowe (*1957) hatte 1996 mit seinem Film JERRY MAGUIRE (Hauptdarsteller: Tom Cruise) einen großen Erfolg. Er drehte zunächst keinen neuen Film, sondern schrieb auf der Basis von zahlreichen Gesprächen ein Buch über Billy Wilder, das 1999 In New York erschien: „Conversations with Wilder“. Die deutsche Erstausgabe wurde 2000 im Diana Verlag veröffentlicht: „Hat es Spaß gemacht, Mr. Wilder?“, übersetzt von Rolf Thissen, illustriert mit zahlreichen Fotos. Eine Textausgabe ist jetzt im Kampa Verlag erschienen, und wer das Buch bisher nicht kennt, sollte es unbedingt lesen, denn Wilder – damals 92 Jahre alt – hatte die außerordentliche Fähigkeit, sich gut an die Produktionshintergründe seiner zahlreichen Filme zu erinnern. Das konnte man schon in Volker Schlöndorffs Dokumentation BILLY WILDER, WIE HABEN SIE’S GEMACHT? (1988) erleben und findet dies in dem fast 500-Seiten-Buch bestätigt. Crowe ist mit Wilders Arbeit als Drehbuchautor und Regisseur bestens vertraut, stellt präzise Fragen und erzählt (kursiv) Reaktionen und Situationen während der Interviews. Das ist unterhaltsam zu lesen, selbst wenn man nicht alle Wilder-Filme kennt. Sehr hilfreich ist der Anhang mit einer Kommentierten Filmografie der Regiearbeiten von Wilder, mit der Rubrik „Vermischtes“ und einem Personen- und Filmregister. Mehr zum Buch: 2019/01/9783311140085.jpg
Der Autor und Regisseur Cameron Crowe (*1957) hatte 1996 mit seinem Film JERRY MAGUIRE (Hauptdarsteller: Tom Cruise) einen großen Erfolg. Er drehte zunächst keinen neuen Film, sondern schrieb auf der Basis von zahlreichen Gesprächen ein Buch über Billy Wilder, das 1999 In New York erschien: „Conversations with Wilder“. Die deutsche Erstausgabe wurde 2000 im Diana Verlag veröffentlicht: „Hat es Spaß gemacht, Mr. Wilder?“, übersetzt von Rolf Thissen, illustriert mit zahlreichen Fotos. Eine Textausgabe ist jetzt im Kampa Verlag erschienen, und wer das Buch bisher nicht kennt, sollte es unbedingt lesen, denn Wilder – damals 92 Jahre alt – hatte die außerordentliche Fähigkeit, sich gut an die Produktionshintergründe seiner zahlreichen Filme zu erinnern. Das konnte man schon in Volker Schlöndorffs Dokumentation BILLY WILDER, WIE HABEN SIE’S GEMACHT? (1988) erleben und findet dies in dem fast 500-Seiten-Buch bestätigt. Crowe ist mit Wilders Arbeit als Drehbuchautor und Regisseur bestens vertraut, stellt präzise Fragen und erzählt (kursiv) Reaktionen und Situationen während der Interviews. Das ist unterhaltsam zu lesen, selbst wenn man nicht alle Wilder-Filme kennt. Sehr hilfreich ist der Anhang mit einer Kommentierten Filmografie der Regiearbeiten von Wilder, mit der Rubrik „Vermischtes“ und einem Personen- und Filmregister. Mehr zum Buch: 2019/01/9783311140085.jpg
22. Mai 2019
„Düsternbrook“
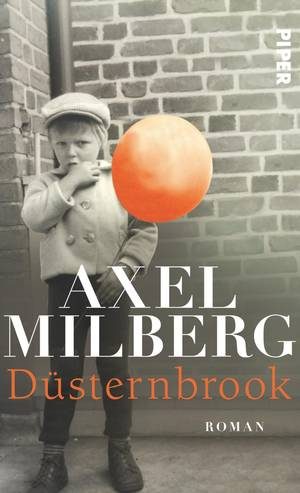 In diesem Roman erzählt der Schauspieler Axel Milberg (*1956) die Geschichte seiner Kindheit und Jugend in dem Kieler Nobelviertel Düstern-brook. Als Sohn eines Rechts-anwalts und einer Ärztin, die ihren Beruf zugunsten der Familie aufgibt, wächst er mit seinem Bruder Hans und seiner Schwester Manuela in behüteten, aber nicht konfliktfreien Verhältnissen auf. In 50 kurzen Kapiteln lässt er uns teilhaben an Erinnerungen, die natürlich auch fiktionale Elemente haben. Es geht um seine Familie, Erlebnisse in der Schule, in den Ferien, um Freunde und Freundinnen, die erste Liebe mit Namen Lili. Auch die Außerirdischen spielen zwischendurch eine Rolle, wenn sie in der Phantasie und vielleicht auch in der Realität auf die Stadt zukommen. Ein Besuch des Autors Erich von Däniken in der Schule wirkt in der Erinnerung nach. Wichtiger ist allerdings die persönliche Begegnung mit dem Schauspieler Gert Fröbe, der in Kiel gastierte und ihn ermutigt, sich an der Otto Falckenberg Schule in München zu bewerben. Er hat damit Erfolg, und so endet der Roman mit dem Wort „Aufgenommen!“. Unter den Romanen von Schauspielern, die in den letzten Jahren erschienen sind („Die Spieluhr“ von Ulrich Tukur, „Raumpatrouille“ von Matthias Brandt, „Vor dem Anfang“ von Burghardt Klaußner, ,,Der Apfelbaum“ von Christian Berkel), kann sich „Düsternbrook“ von Axel Milberg durchaus behaupten. Mehr zum Buch: 978-3-492-05948-0
In diesem Roman erzählt der Schauspieler Axel Milberg (*1956) die Geschichte seiner Kindheit und Jugend in dem Kieler Nobelviertel Düstern-brook. Als Sohn eines Rechts-anwalts und einer Ärztin, die ihren Beruf zugunsten der Familie aufgibt, wächst er mit seinem Bruder Hans und seiner Schwester Manuela in behüteten, aber nicht konfliktfreien Verhältnissen auf. In 50 kurzen Kapiteln lässt er uns teilhaben an Erinnerungen, die natürlich auch fiktionale Elemente haben. Es geht um seine Familie, Erlebnisse in der Schule, in den Ferien, um Freunde und Freundinnen, die erste Liebe mit Namen Lili. Auch die Außerirdischen spielen zwischendurch eine Rolle, wenn sie in der Phantasie und vielleicht auch in der Realität auf die Stadt zukommen. Ein Besuch des Autors Erich von Däniken in der Schule wirkt in der Erinnerung nach. Wichtiger ist allerdings die persönliche Begegnung mit dem Schauspieler Gert Fröbe, der in Kiel gastierte und ihn ermutigt, sich an der Otto Falckenberg Schule in München zu bewerben. Er hat damit Erfolg, und so endet der Roman mit dem Wort „Aufgenommen!“. Unter den Romanen von Schauspielern, die in den letzten Jahren erschienen sind („Die Spieluhr“ von Ulrich Tukur, „Raumpatrouille“ von Matthias Brandt, „Vor dem Anfang“ von Burghardt Klaußner, ,,Der Apfelbaum“ von Christian Berkel), kann sich „Düsternbrook“ von Axel Milberg durchaus behaupten. Mehr zum Buch: 978-3-492-05948-0
21. Mai 2019
Erzählen von China
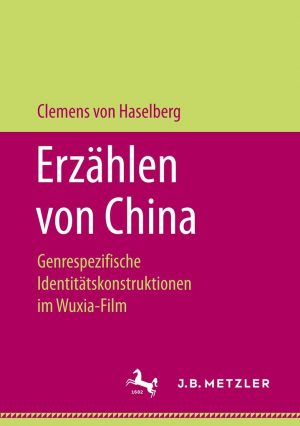 Eine Dissertation, die an der Freien Universität Berlin ent-standen ist. Clemens von Haselberg untersucht darin „Genrespezifische Identitäts-konstruktionen im Wuxia-Film“. Dieses Genre des Schwert-kampffilms gibt es seit den 1920er Jahren. Es wanderte in den 1960er Jahren nach Hongkong und ist inzwischen wieder in China etabliert. Der Autor formuliert in einem grundlegenden Kapitel Definition, Periodisierung und Charakteristika des Wuxia-Filmgenres. In beispielhaften Analysen geht es in den folgenden Kapiteln um Figuren, Handlungsorte und Handlungsmuster in den frühen Wuxia-Filmen der 1920 bis 1960er Jahre, um die Wahrung kultureller Identität und den Verlust der geografischen Heimat in den klassischen Wuxia-Filmen der 1960er bis 1980er Jahre, um die Identifikation mit Hongkong und die Rückkehr zum chinesischen Festland im postklassischen Wuxia-Film der 1980er und 90er Jahre. um nationalistischen Stolz und globalisierte Identitätskrise im zeitgenössischen Wuxia-Film seit der Jahrtausendwende. Die jeweiligen Analysen sind sehr konkret. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: 9783658248574
Eine Dissertation, die an der Freien Universität Berlin ent-standen ist. Clemens von Haselberg untersucht darin „Genrespezifische Identitäts-konstruktionen im Wuxia-Film“. Dieses Genre des Schwert-kampffilms gibt es seit den 1920er Jahren. Es wanderte in den 1960er Jahren nach Hongkong und ist inzwischen wieder in China etabliert. Der Autor formuliert in einem grundlegenden Kapitel Definition, Periodisierung und Charakteristika des Wuxia-Filmgenres. In beispielhaften Analysen geht es in den folgenden Kapiteln um Figuren, Handlungsorte und Handlungsmuster in den frühen Wuxia-Filmen der 1920 bis 1960er Jahre, um die Wahrung kultureller Identität und den Verlust der geografischen Heimat in den klassischen Wuxia-Filmen der 1960er bis 1980er Jahre, um die Identifikation mit Hongkong und die Rückkehr zum chinesischen Festland im postklassischen Wuxia-Film der 1980er und 90er Jahre. um nationalistischen Stolz und globalisierte Identitätskrise im zeitgenössischen Wuxia-Film seit der Jahrtausendwende. Die jeweiligen Analysen sind sehr konkret. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: 9783658248574
19. Mai 2019
Lebenserfahrungen
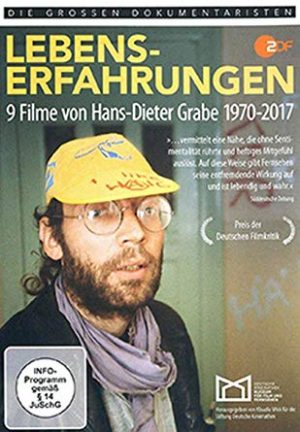 Fast fünfzig Jahre hat Hans-Dieter Grabe für die ZDF-Reihe „Lebenserfahrungen“ dokumen-tarische Filme realisiert. Es waren insgesamt 33. Neun Filme sind jetzt auf zwei DVDs zugänglich, die bei Absolut Medien erschienen sind. In ES GIBT SCHWIERIGE VATER-LÄNDER, EINS DAVON IST DEUTSCHLAND (1970) begleitet Grabe den Bundes-präsidenten Gustav Heinemann auf der Reise in Länder, die von Deutschland im Zweiten Weltkrieg überfallen wurden. GISELA BARTSCH ODER WARUM HABEN SIE DEN MÖRDER GEHEIRATET? (1976) porträtiert eine Krankenschwester, die einen Kindermörder geheiratet hat. In SIMON WIESENTHAL ODER ICH JAGTE EICHMANN (1978) macht sich ein KZ-Überlebender nach dem Ende der Nazi-Zeit auf die Suche nach Verbrechern. TYTTE BOTFELDT: AUFS STERBEN FREU’ ICH MICH (1979) zeigt eine an Krebs erkrankte dänische Adoptionsvermittlerin. DAS WUNDER VON LENGEDE ODER ICH WÜNSCH’ KEINEM, WAS WIR MITGEMACHT HABEN (1979) dokumentiert die seelischen Verwundungen der betroffenen Bergmänner. BERNAUER STRASSE 1 BIS 50 (1981) lässt Mauerflüchtlinge zur Wort kommen. FRITZ TEUFEL ODER WARUM HABEN SIE NICHT GESCHOSSEN? (1982) ist ein persönlicher Rückblick des APO-Kommunarden, der fast acht Jahre im Gefängnis verbracht hat. RAIMUND – EIN JAHR DAVOR (2013) beobachtet Grabes Nachbarn beim Holzfällen; er nimmt sich das Leben, nachdem seine Frau an Krebs gestorben ist. ANTON UND ICH (2017) porträtiert einen alten Bauern und Pensionswirt im Berchtesgadener Land. Hans-Dieter Grabe ist einer der großen Dokumentaristen der Bundesrepublik. Seine Filme sind bewegende Zeitzeugnisse. Mit einem ausführlichen PDF-Booklet. Coverfoto: Fritz Teufel. Mehr zur DVD: Grabe+1970+–+2017
Fast fünfzig Jahre hat Hans-Dieter Grabe für die ZDF-Reihe „Lebenserfahrungen“ dokumen-tarische Filme realisiert. Es waren insgesamt 33. Neun Filme sind jetzt auf zwei DVDs zugänglich, die bei Absolut Medien erschienen sind. In ES GIBT SCHWIERIGE VATER-LÄNDER, EINS DAVON IST DEUTSCHLAND (1970) begleitet Grabe den Bundes-präsidenten Gustav Heinemann auf der Reise in Länder, die von Deutschland im Zweiten Weltkrieg überfallen wurden. GISELA BARTSCH ODER WARUM HABEN SIE DEN MÖRDER GEHEIRATET? (1976) porträtiert eine Krankenschwester, die einen Kindermörder geheiratet hat. In SIMON WIESENTHAL ODER ICH JAGTE EICHMANN (1978) macht sich ein KZ-Überlebender nach dem Ende der Nazi-Zeit auf die Suche nach Verbrechern. TYTTE BOTFELDT: AUFS STERBEN FREU’ ICH MICH (1979) zeigt eine an Krebs erkrankte dänische Adoptionsvermittlerin. DAS WUNDER VON LENGEDE ODER ICH WÜNSCH’ KEINEM, WAS WIR MITGEMACHT HABEN (1979) dokumentiert die seelischen Verwundungen der betroffenen Bergmänner. BERNAUER STRASSE 1 BIS 50 (1981) lässt Mauerflüchtlinge zur Wort kommen. FRITZ TEUFEL ODER WARUM HABEN SIE NICHT GESCHOSSEN? (1982) ist ein persönlicher Rückblick des APO-Kommunarden, der fast acht Jahre im Gefängnis verbracht hat. RAIMUND – EIN JAHR DAVOR (2013) beobachtet Grabes Nachbarn beim Holzfällen; er nimmt sich das Leben, nachdem seine Frau an Krebs gestorben ist. ANTON UND ICH (2017) porträtiert einen alten Bauern und Pensionswirt im Berchtesgadener Land. Hans-Dieter Grabe ist einer der großen Dokumentaristen der Bundesrepublik. Seine Filme sind bewegende Zeitzeugnisse. Mit einem ausführlichen PDF-Booklet. Coverfoto: Fritz Teufel. Mehr zur DVD: Grabe+1970+–+2017
18. Mai 2019
303
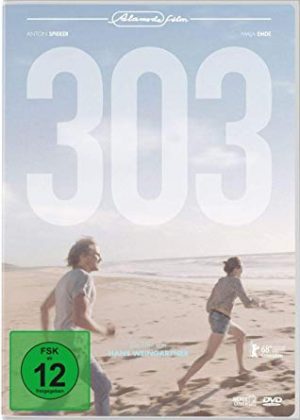 In einem Wohnmobil Mercedes Hymer 303 macht sich die Biologiestudentin Jule, nach-dem sie die letzte Prüfung vor Ende des Sommersemesters nicht bestanden hat, auf den Weg nach Portugal. Dort schreibt ihr Freund Alex gerade seine Doktorarbeit. Jule will Alex persönlich darüber informieren, dass sie von ihm schwanger ist. Kurz nach Berlin trifft sie auf den Politikstudenten Jan, der nach Nordspanien reisen möchte, um dort seinen biologischen Vater kennenzulernen. Sie nimmt ihn mit auf die Reise, die zu einem Roadmovie wird. Jan ist davon überzeugt, dass der Mensch von Natur aus egoistisch ist. Jule dagegen glaubt, dass die Menschen im Kern empathisch und kooperativ sind. Da gibt es viel Gesprächsstoff für den gemeinsamen Trip durch Westeuropa. Der Film von Hans Weingartner dauert 145 Minuten, er nimmt uns mit auf eine Reise, die Ansprüche an unser Denkvermögen stellt und natürlich zu einer immer engeren Verbindung zwischen Jule und Jan führt. Ich finde den Film interessant, weil die Verknüpfung von Dialog und Bildern sehr gelungen ist. Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises hat er leider keine Rolle gespielt. Mala Emde (Jule) und Anto Spieker (Jan) spielen die Hauptrollen. Bei Alamode ist jetzt eine DVD des Films erschienen, die ich sehr empfehle. Mehr zur DVD: 303.html
In einem Wohnmobil Mercedes Hymer 303 macht sich die Biologiestudentin Jule, nach-dem sie die letzte Prüfung vor Ende des Sommersemesters nicht bestanden hat, auf den Weg nach Portugal. Dort schreibt ihr Freund Alex gerade seine Doktorarbeit. Jule will Alex persönlich darüber informieren, dass sie von ihm schwanger ist. Kurz nach Berlin trifft sie auf den Politikstudenten Jan, der nach Nordspanien reisen möchte, um dort seinen biologischen Vater kennenzulernen. Sie nimmt ihn mit auf die Reise, die zu einem Roadmovie wird. Jan ist davon überzeugt, dass der Mensch von Natur aus egoistisch ist. Jule dagegen glaubt, dass die Menschen im Kern empathisch und kooperativ sind. Da gibt es viel Gesprächsstoff für den gemeinsamen Trip durch Westeuropa. Der Film von Hans Weingartner dauert 145 Minuten, er nimmt uns mit auf eine Reise, die Ansprüche an unser Denkvermögen stellt und natürlich zu einer immer engeren Verbindung zwischen Jule und Jan führt. Ich finde den Film interessant, weil die Verknüpfung von Dialog und Bildern sehr gelungen ist. Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises hat er leider keine Rolle gespielt. Mala Emde (Jule) und Anto Spieker (Jan) spielen die Hauptrollen. Bei Alamode ist jetzt eine DVD des Films erschienen, die ich sehr empfehle. Mehr zur DVD: 303.html
17. Mai 2019
Focus on BLOW-UP
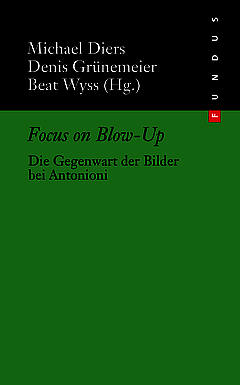 Der Film von Michelangelo Antonioni aus dem Jahr 1966 gilt noch immer als Schlüsselwerk zur Wechselbeziehung zwischen Fotografie und Film. In seiner Reihe „Fundus“ widmet ihm der Verlag Philo Fine Arts einen Band, den Michael Diers, Denis Grünemeier und Beat Wyss herausgegeben haben. In zehn lesenswerten Beiträgen geht es um Form und Technik, Werkstatt und Dingwelt, einen Medienvergleich und Reminiszenzen. Sonja M. Schultz reflektiert über Stillstand und Bewegung, Sinn und Skrupel in Antonionis Film. Denis Grünemeier sieht BLOW-UP als Paradigma einer filmischen Malerei mit Licht und Farbe. Mit drei Beiträgen ist Michael Diers im Buch vertreten: sie beschäftigen sich mit dem Fetisch und seinem (Kunst-)Charakter, dem Aufstand der Zeichen im Studio des Fotografen und mit Musik, Tanz und Bild in BLOW-UP. Volker Pantenburg stellt eine Verbindung zwischen Godard und Antonioni im Jahr 1966 her. Martin Seel untersucht gezielt das Verhältnis von Fotografie und Film in BLOW-UP. Gabriele Brandstetter richtet ihren Blick auf die foto-choreographischen Aktionen im Film. Vera Lehndorff („Veruschka“) erinnert sich in einem Gespräch an die Arbeit mit Antonioni, gefolgt von Auszügen aus dem Film DIE ZEIT MIT ANTONIONI von Wim Wenders. Denis Grünemeier hat eine umfangreiche Literaturliste zu BLOW-UP zusammengestellt. Mehr zum Buch: focus-on-blow-up.html
Der Film von Michelangelo Antonioni aus dem Jahr 1966 gilt noch immer als Schlüsselwerk zur Wechselbeziehung zwischen Fotografie und Film. In seiner Reihe „Fundus“ widmet ihm der Verlag Philo Fine Arts einen Band, den Michael Diers, Denis Grünemeier und Beat Wyss herausgegeben haben. In zehn lesenswerten Beiträgen geht es um Form und Technik, Werkstatt und Dingwelt, einen Medienvergleich und Reminiszenzen. Sonja M. Schultz reflektiert über Stillstand und Bewegung, Sinn und Skrupel in Antonionis Film. Denis Grünemeier sieht BLOW-UP als Paradigma einer filmischen Malerei mit Licht und Farbe. Mit drei Beiträgen ist Michael Diers im Buch vertreten: sie beschäftigen sich mit dem Fetisch und seinem (Kunst-)Charakter, dem Aufstand der Zeichen im Studio des Fotografen und mit Musik, Tanz und Bild in BLOW-UP. Volker Pantenburg stellt eine Verbindung zwischen Godard und Antonioni im Jahr 1966 her. Martin Seel untersucht gezielt das Verhältnis von Fotografie und Film in BLOW-UP. Gabriele Brandstetter richtet ihren Blick auf die foto-choreographischen Aktionen im Film. Vera Lehndorff („Veruschka“) erinnert sich in einem Gespräch an die Arbeit mit Antonioni, gefolgt von Auszügen aus dem Film DIE ZEIT MIT ANTONIONI von Wim Wenders. Denis Grünemeier hat eine umfangreiche Literaturliste zu BLOW-UP zusammengestellt. Mehr zum Buch: focus-on-blow-up.html
16. Mai 2019
Zur Morphologie und Rezeptionsästhetik des anthropomorphen Bösen im Spielfilm
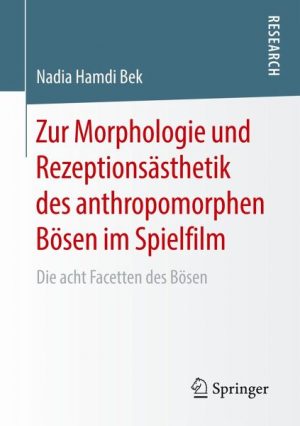 Eine Dissertation, die an der Universität Bonn entstanden ist. Nadia Hamdi Bek untersucht darin in einem dreistufigen Ver-fahren die Reaktion ausgewähl-ter Versuchspersonen auf amo-ralische Filmfiguren. Auf 75 Seiten wird zunächst der theore-tische Hintergrund geklärt. In der Studie I haben dann 23 Versuchspersonen 30 amora-lische Filmcharaktere ausge-wählt, die in den folgenden Stufen von anderen Versuchs-personen, die sich via Internet beteiligten, auf spezielle Merkmale befragt wurden. Zu den „Bösen“ gehören u.a. Anton Chigurth (gespielt von Javier Bardem) in NO COUNTRY FOR OLD MEN (2005) von Joel & Ethan Coen, „The Butcher“ (gespielt von Daniel Day-Lewis) in GANGS OF NEW YORK (2002) von Martin Scorsese, Frank Booth (gespielt von Dennis Hopper) in BLUE VELVET (1986) von David Lynch, Hannibal Lecter (gespielt von Anthony Hopkins) in THE SILENCE OF THE LAMBS (1991) von Jonathan Demme, Michael Myers (gespielt von Nick Castle) in HALLOWEEN (1978) von John Carpenter, Nurse Ratches (gespielt von Louise Fletcher) in ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST (1975) von Milos Forman, Norman Bates (gespielt von Anthony Perkins) in PSYCHO (1960) von Alfred Hitchcock, „The Joker“ (gespielt von Heath Ledger) in THE DARK KNIGHT (2008) von Christopher Nolan. In der Studie II wurden die Versuchspersonen zu den Merkmalen Moral, Realismus und Attraktivität befragt. In der Studie III geht es um Involvement, Distanz, Appreciation und Faszinationspotential. Das ist, dem Anspruch einer Dissertation folgend, sehr theoretisch und für mich nicht immer zu verstehen. Ohne Abbildungen aus Filmen, mit zahlreichen Tabellen und Pfaddiagrammen. Mehr zum Buch: /365824979X
Eine Dissertation, die an der Universität Bonn entstanden ist. Nadia Hamdi Bek untersucht darin in einem dreistufigen Ver-fahren die Reaktion ausgewähl-ter Versuchspersonen auf amo-ralische Filmfiguren. Auf 75 Seiten wird zunächst der theore-tische Hintergrund geklärt. In der Studie I haben dann 23 Versuchspersonen 30 amora-lische Filmcharaktere ausge-wählt, die in den folgenden Stufen von anderen Versuchs-personen, die sich via Internet beteiligten, auf spezielle Merkmale befragt wurden. Zu den „Bösen“ gehören u.a. Anton Chigurth (gespielt von Javier Bardem) in NO COUNTRY FOR OLD MEN (2005) von Joel & Ethan Coen, „The Butcher“ (gespielt von Daniel Day-Lewis) in GANGS OF NEW YORK (2002) von Martin Scorsese, Frank Booth (gespielt von Dennis Hopper) in BLUE VELVET (1986) von David Lynch, Hannibal Lecter (gespielt von Anthony Hopkins) in THE SILENCE OF THE LAMBS (1991) von Jonathan Demme, Michael Myers (gespielt von Nick Castle) in HALLOWEEN (1978) von John Carpenter, Nurse Ratches (gespielt von Louise Fletcher) in ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST (1975) von Milos Forman, Norman Bates (gespielt von Anthony Perkins) in PSYCHO (1960) von Alfred Hitchcock, „The Joker“ (gespielt von Heath Ledger) in THE DARK KNIGHT (2008) von Christopher Nolan. In der Studie II wurden die Versuchspersonen zu den Merkmalen Moral, Realismus und Attraktivität befragt. In der Studie III geht es um Involvement, Distanz, Appreciation und Faszinationspotential. Das ist, dem Anspruch einer Dissertation folgend, sehr theoretisch und für mich nicht immer zu verstehen. Ohne Abbildungen aus Filmen, mit zahlreichen Tabellen und Pfaddiagrammen. Mehr zum Buch: /365824979X
15. Mai 2019
Filmische Raumkonstruktion und Inszenierung städtischen Raums
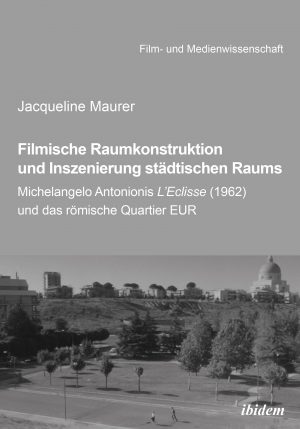 Eine Masterarbeit, die an der Universität Basel entstanden ist. Jacqueline Maurer analysiert darin die Figurenkonstellation von Michelangelo Antonionis Film L’ECLISSE (1962) in Innen- und Außenräumen. Der Film beginnt mit der Trennung der Übersetzerin Vittoria (Monica Vitti) von ihrem langjährigen Freund Riccardo (Francisco Rabal). Sie lernt den jungen Börsenmakler Piero (Alain Delon) kennen, beginnt eine Beziehung zu ihm, die aber keine Zukunft hat. Eine wichtige Rolle in Antonionis Film spielt das römische Quartier EUR, das Anfang der 40er Jahre zur geplanten Weltausstellung erbaut, aber erst in den 50er Jahren vollendet wurde. Die zum Teil monumentale Architektur hat starke bildliche Wirkungen, die von der Autorin präzise beschrieben werden. Hinter der Kamera stand damals Gianni di Venanzo. 492 Quellenverweise wirken für ein 150-Seiten-Buch etwas übertrieben. Die Analysen sind von Abbildungen in akzeptabler Qualität begleitet. Mehr zum Buch: staedtischen-raums.html
Eine Masterarbeit, die an der Universität Basel entstanden ist. Jacqueline Maurer analysiert darin die Figurenkonstellation von Michelangelo Antonionis Film L’ECLISSE (1962) in Innen- und Außenräumen. Der Film beginnt mit der Trennung der Übersetzerin Vittoria (Monica Vitti) von ihrem langjährigen Freund Riccardo (Francisco Rabal). Sie lernt den jungen Börsenmakler Piero (Alain Delon) kennen, beginnt eine Beziehung zu ihm, die aber keine Zukunft hat. Eine wichtige Rolle in Antonionis Film spielt das römische Quartier EUR, das Anfang der 40er Jahre zur geplanten Weltausstellung erbaut, aber erst in den 50er Jahren vollendet wurde. Die zum Teil monumentale Architektur hat starke bildliche Wirkungen, die von der Autorin präzise beschrieben werden. Hinter der Kamera stand damals Gianni di Venanzo. 492 Quellenverweise wirken für ein 150-Seiten-Buch etwas übertrieben. Die Analysen sind von Abbildungen in akzeptabler Qualität begleitet. Mehr zum Buch: staedtischen-raums.html