20. Juli 2017
Heartland
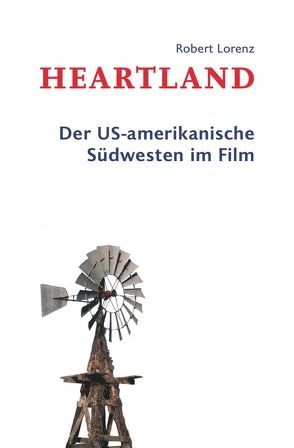 Robert Lorenz ist Politikwissen-schaftler an der Universität Göttingen und cinephil. Als side project betreibt er die Website www.filmkuratorium.de und publiziert dort Filmkritiken. Jetzt hat er im Eigenverlag das Buch „Heartland“ veröffentlicht, das ich mit großem Interesse gelesen habe. Dreißig Texte erinnern an ameri-kanische Filme der 1950er, 60er und 70er Jahre, die im Südwesten der USA spielen, zugeordnet den Kapiteln „Der alte Westen“, „Die große Depression“, „Verspätete Moderne“ und „Amerikanische Träume“. Es sind Filme von Robert Altman (MCCABE & MRS. MILLER, NASHVILLE), Arthur Penn (THE CHASE, THE MISSOURI BREAKS) und Sydney Pollack (JEREMIAH JOHNSON, THE ELECTRIC HORSEMAN, THIS PROPERTY IS CONDEMNED), von Robert Aldrich (APACHE), Peter Bogdanovich (THE LAST PICTURE SHOW), Richard Brooks (ELMER GANTRY), Clint Eastwood (THE OUTLAW JOSEY WALES), John Huston (FAT CITY) und Elia Kazan (WILD RIVER) darunter. Auf vier bis acht Seiten beschreibt der Autor die Handlung, würdigt die darstellerischen Leistungen und die formalen Qualitäten der Filme und stellt sie in den größeren Zusammenhang der Region. Fünf Texte haben mir ganz besonders gut gefallen: über THE BALLAD OF CABLE HOGUE von Sam Peckinpah, BOUND FOR GLORY von Hal Ashby, PICNIC von Joshua Logan, THE LONG HOT SUMMER von Martin Ritt und NASHVILLE von Robert Altman. Ich werde mir die Filme in den nächsten Wochen sicherlich wieder einmal ansehen. Das Buch enthält keine Abbildungen, und das hat auch eine Logik. Mehr zum Buch: 23254213-1#information
Robert Lorenz ist Politikwissen-schaftler an der Universität Göttingen und cinephil. Als side project betreibt er die Website www.filmkuratorium.de und publiziert dort Filmkritiken. Jetzt hat er im Eigenverlag das Buch „Heartland“ veröffentlicht, das ich mit großem Interesse gelesen habe. Dreißig Texte erinnern an ameri-kanische Filme der 1950er, 60er und 70er Jahre, die im Südwesten der USA spielen, zugeordnet den Kapiteln „Der alte Westen“, „Die große Depression“, „Verspätete Moderne“ und „Amerikanische Träume“. Es sind Filme von Robert Altman (MCCABE & MRS. MILLER, NASHVILLE), Arthur Penn (THE CHASE, THE MISSOURI BREAKS) und Sydney Pollack (JEREMIAH JOHNSON, THE ELECTRIC HORSEMAN, THIS PROPERTY IS CONDEMNED), von Robert Aldrich (APACHE), Peter Bogdanovich (THE LAST PICTURE SHOW), Richard Brooks (ELMER GANTRY), Clint Eastwood (THE OUTLAW JOSEY WALES), John Huston (FAT CITY) und Elia Kazan (WILD RIVER) darunter. Auf vier bis acht Seiten beschreibt der Autor die Handlung, würdigt die darstellerischen Leistungen und die formalen Qualitäten der Filme und stellt sie in den größeren Zusammenhang der Region. Fünf Texte haben mir ganz besonders gut gefallen: über THE BALLAD OF CABLE HOGUE von Sam Peckinpah, BOUND FOR GLORY von Hal Ashby, PICNIC von Joshua Logan, THE LONG HOT SUMMER von Martin Ritt und NASHVILLE von Robert Altman. Ich werde mir die Filme in den nächsten Wochen sicherlich wieder einmal ansehen. Das Buch enthält keine Abbildungen, und das hat auch eine Logik. Mehr zum Buch: 23254213-1#information
19. Juli 2017
Rundfunkveranstalter und freie Produzenten
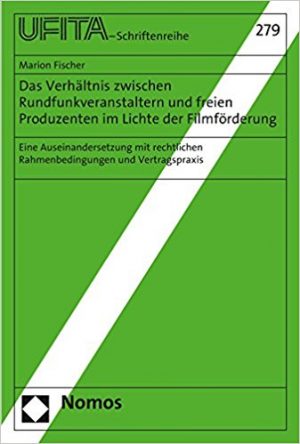 „Das Verhältnis zwischen Rundfunkveranstaltern und freien Produzenten im Lichte der Filmförderung“ ist Thema einer juristischen Dissertation, die 2016 an der Universität Freiburg entstanden ist. Marion Fischer wirft darin einen Blick zurück auf die rechtlichen Rahmen-bedingungen des deutschen Filmförderungsgesetzes, das vor rund fünfzig Jahren, am 1. Januar 1968, in Kraft getreten ist und seither in regelmäßigen Abständen novelliert wurde. Im ersten Kapitel liefert die Autorin die notwendigen Begriffsklärungen: Film, Produzent, Filmförderung. Ihr Text über „Geschichte, Struktur und Umfang der deutschen Filmförderung“ (S. 39-56) ist in diesem Zusammenhang konzise und informativ. Sie unterscheidet dabei vor allem zwischen Bundesfilm-förderung und Förderung auf Länderebene, bei der sie sich auf den FilmFernsehFonds Bayern und die Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen konzentriert. Im zweiten Kapitel stehen die rechtlichen Rahmenbedingungen der Filmförderung durch die Rundfunkveranstalter im Mittelpunkt. Es wird dabei nach der Gesetzgebungskompetenz für das Filmförderungsgesetzt gefragt und nach der Verfassungsmäßigkeit des Filmabgabensystems (Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts 2009 und Urteil des Bundesverfas-sungsgerichts 2014). Im dritten Kapitel geht es um die Auswertung geförderter Filme durch die Rundfunkveranstalter, um das Verhältnis von Vergütung zu Rechteübertragung, um spezielle Regelungen, um Lösungsansätze und Verbesserungsvorschläge. Hier wird auch auf die rechtliche Praxis in anderen Ländern (Frankreich, Großbritannien, USA) hingewiesen. Der Text bleibt durchgehend auf einer juristischen Ebene und wird nicht mit Beispielen konkretisiert. Es wird trotzdem sehr deutlich, wo die Differenzen der Interessen zwischen Rundfunkveranstaltern und freien Produzenten liegen und dass es vieler Kompromisse bedarf, um zu einer Solidarität zu finden. Mehr zum Buch: product=27612
„Das Verhältnis zwischen Rundfunkveranstaltern und freien Produzenten im Lichte der Filmförderung“ ist Thema einer juristischen Dissertation, die 2016 an der Universität Freiburg entstanden ist. Marion Fischer wirft darin einen Blick zurück auf die rechtlichen Rahmen-bedingungen des deutschen Filmförderungsgesetzes, das vor rund fünfzig Jahren, am 1. Januar 1968, in Kraft getreten ist und seither in regelmäßigen Abständen novelliert wurde. Im ersten Kapitel liefert die Autorin die notwendigen Begriffsklärungen: Film, Produzent, Filmförderung. Ihr Text über „Geschichte, Struktur und Umfang der deutschen Filmförderung“ (S. 39-56) ist in diesem Zusammenhang konzise und informativ. Sie unterscheidet dabei vor allem zwischen Bundesfilm-förderung und Förderung auf Länderebene, bei der sie sich auf den FilmFernsehFonds Bayern und die Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen konzentriert. Im zweiten Kapitel stehen die rechtlichen Rahmenbedingungen der Filmförderung durch die Rundfunkveranstalter im Mittelpunkt. Es wird dabei nach der Gesetzgebungskompetenz für das Filmförderungsgesetzt gefragt und nach der Verfassungsmäßigkeit des Filmabgabensystems (Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts 2009 und Urteil des Bundesverfas-sungsgerichts 2014). Im dritten Kapitel geht es um die Auswertung geförderter Filme durch die Rundfunkveranstalter, um das Verhältnis von Vergütung zu Rechteübertragung, um spezielle Regelungen, um Lösungsansätze und Verbesserungsvorschläge. Hier wird auch auf die rechtliche Praxis in anderen Ländern (Frankreich, Großbritannien, USA) hingewiesen. Der Text bleibt durchgehend auf einer juristischen Ebene und wird nicht mit Beispielen konkretisiert. Es wird trotzdem sehr deutlich, wo die Differenzen der Interessen zwischen Rundfunkveranstaltern und freien Produzenten liegen und dass es vieler Kompromisse bedarf, um zu einer Solidarität zu finden. Mehr zum Buch: product=27612
18. Juli 2017
Väter allerlei Geschlechts
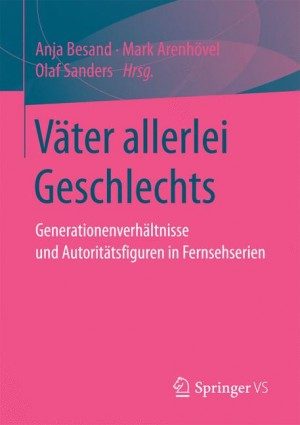 Ein Sammelband mit sieben Texten zu „Generationenverhält-nissen und Autoritätsfiguren in Fernsehserien“ (UT), herausge-geben von Anja Besand / Mark Arenhövel (TU Dresden) und Olaf Sanders (Helmut Schmidt-Universität Hamburg). Es geht um „Intergenerationenambi-valenz“, wie ich aus dem Vor-wort gelernt habe. Brigitte Georgi-Findlay geht in ihrem Beitrag relativ weit zurück in die Geschichte und erinnert am Beispiel von BONANZA an Ben Cartwright und andere Väter. Katja Kanzler schreibt über „Das Lustige, das Lächerliche und Vorstellungen von der ‚guten Familie’ in Sitcoms“. Ihre Beispiele sind FATHER KNOWS BEST, MODERN FAMILY und BLACK-ISH. Karl-Josef Pazzini und Olaf Sanders richten ihren Blick auf das „Väterliche Prekariat in THE SOPRANOS“. Mirjam M. Frotscher und Gesine Wegner sind „Auf der Suche nach Trans*gressiver Elternschaft im US-amerikanischen Fernsehen“ und beschäftigen sich mit den Serien THE L WORLD, ORANGE IS THE NEW BLACK und TRANSPARENT. Christian Schwarke (Theologe) analysiert die Serien LOW WINTER SUN, TRUE DETECTIVE und THE WIRE vor dem Hintergrund der Geschichte der sogenannten Opferung Isaaks aus dem Buch Genesis des Alten Testaments. Mark Arenhövel konstatiert eine Destruierung der leitenden Wertvorstellungen von Ehe und Familie in der sehr erfolgreichen Serie BREAKING BAD. Anja Besand fragt in dem abschließenden Beitrag „Von einsamen Müttern und verzweifelten Vätern“, ob Fernsehserien als Erziehungsratgeber geeignet sind. Ihre Beispiele sind THE SOPRANOS und THE WALKIND DEAD. Ein interessanter Band im Zusammenhang des Fernsehserien-Diskurses. Die Qualität der Abbildungen ist nur im letzten Beitrag akzeptabel. Mehr zum Buch: book/9783658164232
Ein Sammelband mit sieben Texten zu „Generationenverhält-nissen und Autoritätsfiguren in Fernsehserien“ (UT), herausge-geben von Anja Besand / Mark Arenhövel (TU Dresden) und Olaf Sanders (Helmut Schmidt-Universität Hamburg). Es geht um „Intergenerationenambi-valenz“, wie ich aus dem Vor-wort gelernt habe. Brigitte Georgi-Findlay geht in ihrem Beitrag relativ weit zurück in die Geschichte und erinnert am Beispiel von BONANZA an Ben Cartwright und andere Väter. Katja Kanzler schreibt über „Das Lustige, das Lächerliche und Vorstellungen von der ‚guten Familie’ in Sitcoms“. Ihre Beispiele sind FATHER KNOWS BEST, MODERN FAMILY und BLACK-ISH. Karl-Josef Pazzini und Olaf Sanders richten ihren Blick auf das „Väterliche Prekariat in THE SOPRANOS“. Mirjam M. Frotscher und Gesine Wegner sind „Auf der Suche nach Trans*gressiver Elternschaft im US-amerikanischen Fernsehen“ und beschäftigen sich mit den Serien THE L WORLD, ORANGE IS THE NEW BLACK und TRANSPARENT. Christian Schwarke (Theologe) analysiert die Serien LOW WINTER SUN, TRUE DETECTIVE und THE WIRE vor dem Hintergrund der Geschichte der sogenannten Opferung Isaaks aus dem Buch Genesis des Alten Testaments. Mark Arenhövel konstatiert eine Destruierung der leitenden Wertvorstellungen von Ehe und Familie in der sehr erfolgreichen Serie BREAKING BAD. Anja Besand fragt in dem abschließenden Beitrag „Von einsamen Müttern und verzweifelten Vätern“, ob Fernsehserien als Erziehungsratgeber geeignet sind. Ihre Beispiele sind THE SOPRANOS und THE WALKIND DEAD. Ein interessanter Band im Zusammenhang des Fernsehserien-Diskurses. Die Qualität der Abbildungen ist nur im letzten Beitrag akzeptabel. Mehr zum Buch: book/9783658164232
16. Juli 2017
THIS GUN FOR HIRE (1942) / THE BIG STEAL (1949)
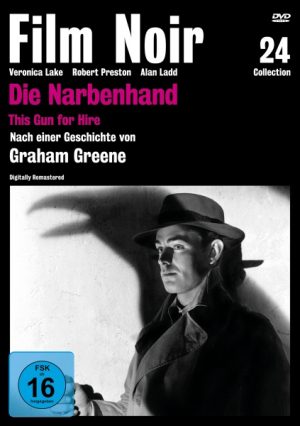 Zwei neue DVDs in der Film Noir-Reihe von Koch Media. THIS GUN FOR HIRE von Frank Tuttle nach einem Roman von Graham Greene gilt als ein Klassiker des frühen Film Noir. Die Hauptfigur ist Philipp Raven (gespielt von Alan Ladd), ein professioneller Killer, den seine Aufraggeber in eine Falle locken wollen, indem sie ihn mit gefälschten Banknoten bezahlen, die der Polizei bekannt sind. Raven will sich rächen, lernt außer-dem die attraktive Sängerin Ellen Graham (Veronika Lake) kennen, die für den Geheimdienst tätig ist und von ihm als Geisel genommen wird. Am Ende bleibt Raven auf der Strecke. Politischer Hintergrund des Films sind Giftgasformeln eines amerikanischen Konzerns, die unerlaubterweise verkauft werden sollen, auch Japan ist daran interessiert. Die Bilder des Films – Kamera: John F. Seitz – sind phänomenal in ihren Schwarzweißkontrasten. Allan Ladd spielt mit seinem Engelsgesicht den Killer und klärt am Ende auch das Geheimnis seiner Narbenhand auf: seine Tante hat sie ihm als Kind mit einem Bügeleisen zerschlagen, und er hat sie dafür umgebracht. Das Booklet der DVD stammt von Frank Arnold und ist sehr informativ. Mehr zur DVD: 24_die_narbenhand_dvd/
Zwei neue DVDs in der Film Noir-Reihe von Koch Media. THIS GUN FOR HIRE von Frank Tuttle nach einem Roman von Graham Greene gilt als ein Klassiker des frühen Film Noir. Die Hauptfigur ist Philipp Raven (gespielt von Alan Ladd), ein professioneller Killer, den seine Aufraggeber in eine Falle locken wollen, indem sie ihn mit gefälschten Banknoten bezahlen, die der Polizei bekannt sind. Raven will sich rächen, lernt außer-dem die attraktive Sängerin Ellen Graham (Veronika Lake) kennen, die für den Geheimdienst tätig ist und von ihm als Geisel genommen wird. Am Ende bleibt Raven auf der Strecke. Politischer Hintergrund des Films sind Giftgasformeln eines amerikanischen Konzerns, die unerlaubterweise verkauft werden sollen, auch Japan ist daran interessiert. Die Bilder des Films – Kamera: John F. Seitz – sind phänomenal in ihren Schwarzweißkontrasten. Allan Ladd spielt mit seinem Engelsgesicht den Killer und klärt am Ende auch das Geheimnis seiner Narbenhand auf: seine Tante hat sie ihm als Kind mit einem Bügeleisen zerschlagen, und er hat sie dafür umgebracht. Das Booklet der DVD stammt von Frank Arnold und ist sehr informativ. Mehr zur DVD: 24_die_narbenhand_dvd/
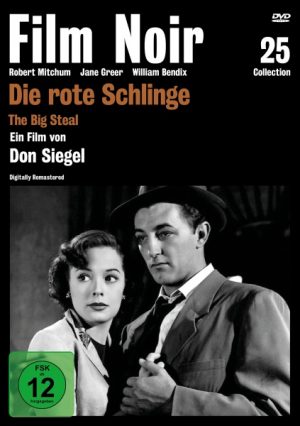 THE BIG STEAL ist ein früher, relativ unbekannter Film von Don Siegel, bei dem es um Regierungsgelder, einen Bankraub, den Täter, den in Verdacht geratenen Buch-halter und den ermittelnden Kriminalkommissar geht, die sich in einer wilden Jagd verfolgen. Auch eine Frau mischt sich ins Geschehen ein, sie wird von Jane Greer gespielt. Weite Teile des Films wurden in Mexiko gedreht. Der Film hat überraschend viele komische Momente und – für einen Film noir ungewöhnlich – auch ein Happyend. Die Hauptrolle, den Bankbeamten Duke Halliday, spielt Robert Mitchum, der Ende der 1940er Jahre wegen eines Rauschgiftdelikts 50 Tage im Gefängnis verbringen musste. Über diese Hintergründe informiert Michael Althen in seinem wunderbaren Mitchum-Buch (Heyne 1986). Viele Fakten zur Produktion des Films mit dem deutschen Titel DIE ROTE SCHLINGE enthält auch das Booklet zur DVD, das wieder Frank Arnold geschrieben hat. Zum Bonusmaterial gehört eine kolorierte Farbfassung (72 min.). Mehr zur DVD:25_die_rote_schlinge_dvd/
THE BIG STEAL ist ein früher, relativ unbekannter Film von Don Siegel, bei dem es um Regierungsgelder, einen Bankraub, den Täter, den in Verdacht geratenen Buch-halter und den ermittelnden Kriminalkommissar geht, die sich in einer wilden Jagd verfolgen. Auch eine Frau mischt sich ins Geschehen ein, sie wird von Jane Greer gespielt. Weite Teile des Films wurden in Mexiko gedreht. Der Film hat überraschend viele komische Momente und – für einen Film noir ungewöhnlich – auch ein Happyend. Die Hauptrolle, den Bankbeamten Duke Halliday, spielt Robert Mitchum, der Ende der 1940er Jahre wegen eines Rauschgiftdelikts 50 Tage im Gefängnis verbringen musste. Über diese Hintergründe informiert Michael Althen in seinem wunderbaren Mitchum-Buch (Heyne 1986). Viele Fakten zur Produktion des Films mit dem deutschen Titel DIE ROTE SCHLINGE enthält auch das Booklet zur DVD, das wieder Frank Arnold geschrieben hat. Zum Bonusmaterial gehört eine kolorierte Farbfassung (72 min.). Mehr zur DVD:25_die_rote_schlinge_dvd/
14. Juli 2017
Film Noir
 Am Ende seines präzise und konzentriert formulierten Textes stellt Thomas Brandl-meier fest, dass der Film noir nicht nur – wie Paul Schrader und Raymund Durgnat in den 70er Jahren konstatierten – ein Stil, sondern ein Genre ist, genauer: ein Subgenre des Melodrams, und zitiert Um-berto Eco: „Zwei Klischees sind lächerlich, hundert Klischees sind ergreifend. Denn irgendwie geht einem plötzlich auf, dass die Klischees miteinander sprechen und ein Fest des Wiedersehens feiern“. Der Autor fokussiert seinen Essay (70 Seiten) auf die Zeit von 1941 bis 1955 und thematisiert mit konkreten Filmbeispielen die veränderten Geschlechterrollen, Amnesie und Nachkriegsschock, moralische Ambiguität, politische Polarisierung, Kalten Krieg und atomare Bedrohung, Paranoia, Entfremdung und Klaustrophobie, psychosomatische Motive, Fetischismus, Amnesie und Verdrängung, Nekrophilie, den homme fatal und den Fetischcharakter des Geldes. Natürlich ist Brandlmeier mit den 158 Filmen, die er im Anhang dem Genre zuordnet, bestens vertraut. Die 310 Fotos auf 60 Bildseiten bilden eine zweite Ebene mit Schnittpunkten zum Text, aber auch eigenständigen, pointierten Ideen (zum Beispiel: Feuer geben und Rauchen, S. 71, Black widow und Femme fatale, S. 103-105). Keine Einführung ins Thema, für Kenner der Filme eine spannende Lektüre. Die Abbildungen sind dank der Papierqualität erstaunlich gut. Coverfoto: am Set von SUNSET BOULEVARD. Mehr zum Buch: WWODaSiJbV4
Am Ende seines präzise und konzentriert formulierten Textes stellt Thomas Brandl-meier fest, dass der Film noir nicht nur – wie Paul Schrader und Raymund Durgnat in den 70er Jahren konstatierten – ein Stil, sondern ein Genre ist, genauer: ein Subgenre des Melodrams, und zitiert Um-berto Eco: „Zwei Klischees sind lächerlich, hundert Klischees sind ergreifend. Denn irgendwie geht einem plötzlich auf, dass die Klischees miteinander sprechen und ein Fest des Wiedersehens feiern“. Der Autor fokussiert seinen Essay (70 Seiten) auf die Zeit von 1941 bis 1955 und thematisiert mit konkreten Filmbeispielen die veränderten Geschlechterrollen, Amnesie und Nachkriegsschock, moralische Ambiguität, politische Polarisierung, Kalten Krieg und atomare Bedrohung, Paranoia, Entfremdung und Klaustrophobie, psychosomatische Motive, Fetischismus, Amnesie und Verdrängung, Nekrophilie, den homme fatal und den Fetischcharakter des Geldes. Natürlich ist Brandlmeier mit den 158 Filmen, die er im Anhang dem Genre zuordnet, bestens vertraut. Die 310 Fotos auf 60 Bildseiten bilden eine zweite Ebene mit Schnittpunkten zum Text, aber auch eigenständigen, pointierten Ideen (zum Beispiel: Feuer geben und Rauchen, S. 71, Black widow und Femme fatale, S. 103-105). Keine Einführung ins Thema, für Kenner der Filme eine spannende Lektüre. Die Abbildungen sind dank der Papierqualität erstaunlich gut. Coverfoto: am Set von SUNSET BOULEVARD. Mehr zum Buch: WWODaSiJbV4
13. Juli 2017
Medialität der Mise-en-scène
 Eigentlich ein Wahnsinn: Ein 900-Seiten-Buch über den Be-griff „Mise-en-scène“, ange-wandt auf den Film speziell der 1950er Jahre. Es geht um die Konstitution des Raumes für die Kamera und die Auflösung des Raumes in der Zeit. Einerseits bewegt sich Ivo Ritzer in seiner Habilitationsschrift im theore-tischen Bereich von Definitio-nen und historischen Deutun-gen. Andererseits werden die „Mavericks“ der 1950er Jahre zwischen Classic Hollywood und New Hollywood sehr beein-druckend in Erinnerung gerufen. Im Mittelpunkt stehen zwölf Regisseure und eine Regisseurin: Robert Aldrich, Jack Arnold, Budd Boetticher, John Frankenheimer, Sam Fuller, Phil Karlson, Joseph H. Lewis, Gerd Oswald, Don Siegel, Andre de Toth, Jacques Tourneur, Paul Wendkos und Ida Lupino. Ein eigenes Kapitel ist Nicholas Ray gewidmet. Die Unterschiedlichkeit der Genres wird natürlich berücksichtigt. Auch die Veränderungen von Schwarzweiß zu Farbe und die Öffnung der Leinwand in die Breite spielen eine Rolle. Originalschauplätze und Studiobauten werden spezifiziert. Fernsehfilme erhalten eine Gleichberechtigung mit Kinofilmen, sie wurden damals von vielen der genannten Regisseure realisiert. Besonders gut gefallen hat mir das Unterkapitel über die Tiefenschärfe bei der Mise-en-scène (S. 375-441), in dem der Autor sich von der wissenschaftlichen Literatur weitgehend freimacht und eigene Beobachtungen formuliert. Speziell das Kapitel „Form/Inhalt. Zum cinephilen Diskurs der Mise-en-scène“ wird sehr von Zitaten beherrscht. Insgesamt gibt es 1.496 Quellenverweise. Das macht die Lektüre nicht einfach, aber eine Habilitationsschrift stellt eben besondere Ansprüche. Immer dann, wenn Ivo Ritzer konkret Sequenzen beschreibt, bekommt sein Text individuelle Kraft. Das Vorwort stammt von Elisabeth Bronfen. Mit 590 Abbildungen in Schwarzweiß und Farbe in meist guter oder zumindest akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: book/9783658135690
Eigentlich ein Wahnsinn: Ein 900-Seiten-Buch über den Be-griff „Mise-en-scène“, ange-wandt auf den Film speziell der 1950er Jahre. Es geht um die Konstitution des Raumes für die Kamera und die Auflösung des Raumes in der Zeit. Einerseits bewegt sich Ivo Ritzer in seiner Habilitationsschrift im theore-tischen Bereich von Definitio-nen und historischen Deutun-gen. Andererseits werden die „Mavericks“ der 1950er Jahre zwischen Classic Hollywood und New Hollywood sehr beein-druckend in Erinnerung gerufen. Im Mittelpunkt stehen zwölf Regisseure und eine Regisseurin: Robert Aldrich, Jack Arnold, Budd Boetticher, John Frankenheimer, Sam Fuller, Phil Karlson, Joseph H. Lewis, Gerd Oswald, Don Siegel, Andre de Toth, Jacques Tourneur, Paul Wendkos und Ida Lupino. Ein eigenes Kapitel ist Nicholas Ray gewidmet. Die Unterschiedlichkeit der Genres wird natürlich berücksichtigt. Auch die Veränderungen von Schwarzweiß zu Farbe und die Öffnung der Leinwand in die Breite spielen eine Rolle. Originalschauplätze und Studiobauten werden spezifiziert. Fernsehfilme erhalten eine Gleichberechtigung mit Kinofilmen, sie wurden damals von vielen der genannten Regisseure realisiert. Besonders gut gefallen hat mir das Unterkapitel über die Tiefenschärfe bei der Mise-en-scène (S. 375-441), in dem der Autor sich von der wissenschaftlichen Literatur weitgehend freimacht und eigene Beobachtungen formuliert. Speziell das Kapitel „Form/Inhalt. Zum cinephilen Diskurs der Mise-en-scène“ wird sehr von Zitaten beherrscht. Insgesamt gibt es 1.496 Quellenverweise. Das macht die Lektüre nicht einfach, aber eine Habilitationsschrift stellt eben besondere Ansprüche. Immer dann, wenn Ivo Ritzer konkret Sequenzen beschreibt, bekommt sein Text individuelle Kraft. Das Vorwort stammt von Elisabeth Bronfen. Mit 590 Abbildungen in Schwarzweiß und Farbe in meist guter oder zumindest akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: book/9783658135690
12. Juli 2017
Wer beherrscht die Medien?
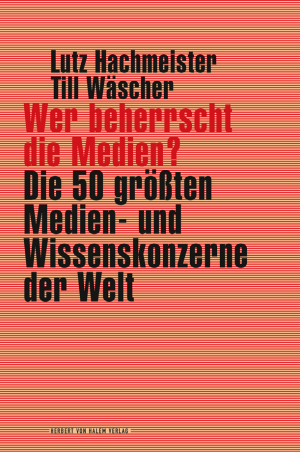 Für die Größe der Medien-konzerne sind nackte Zahlen entscheidend: ihre jährlichen Umsätze. Die Veränderungen wirken ziemlich dramatisch. 2005 hießen die weltweit größten Fünf: 1. Time Warner Inc., 2. Walt Disney Comp., 3. Viacom Inc./CBS Corp., 4. News Corp. Ltd., 5. Bertelsmann SE & Co. Im vergangenen Jahr 2016 war die Reihenfolge: 1. Alphabet Inc. (mit Google), 2. Comcast Corp., 3. Walt Disney Comp., 4. News Corp., 5. AT&T Entertainment Group. Apple liegt auf Platz 9, Facebook auf Platz 13. Bertels-mann ist auf Platz 11 abgerutscht. Das Buch von Lutz Hachmeister und Till Wäscher über die fünfzig größten Medien- und Wissenskonzerne ist beeindruckend in der Faktensammlung und lesenswert dank der konkreten Texte. Auf insgesamt 460 Seiten wird jeder Konzern mit einem kurzen Überblick vorgestellt, mit seinen Basisdaten und dem verantwortlichen Management, dann folgen Texte zu Geschichte und Profil, zu Geschäftsfeldern und aktueller Entwicklung. Ein Einleitungstext der Herausgeber reflektiert über die aktuelle Bedeutung der Wissens- und Datenkonzerne, ein zweiter Text – von Lutz Hachmeister – erinnert an die Situation 2005: „Die Kulturen der Medienkonzerne“. Unter den Konzernporträts fand ich Time Warner, Sony, Apple, Vivendi, Microsoft, BBC und ARD (Plätze 28 und 29), Netflix, Amazon (Platz 33), Yahoo und Nintendo besonders interessant. Über die Plätze 51 bis 100 informiert eine spezielle Tabelle. Springer liegt auf Platz 52, ProSiebenSAT1 auf 53, Bauer Media auf 71, Hubert Burda auf 72, das ZDF auf 74, Georg von Holtzbrinck auf 83. Und natürlich gibt es Konzerne auch in China, Indien, Skandinavien oder Großbritannien. Man kann beim Lesen auf eigenen Wegen die Welt durchqueren. Und macht sich am Ende Gedanken, wie die Situation in zehn Jahren sein wird. Erschienen im Herbert von Halem Verlag. Mehr zum Buch: wer-beherrscht-die-medien/
Für die Größe der Medien-konzerne sind nackte Zahlen entscheidend: ihre jährlichen Umsätze. Die Veränderungen wirken ziemlich dramatisch. 2005 hießen die weltweit größten Fünf: 1. Time Warner Inc., 2. Walt Disney Comp., 3. Viacom Inc./CBS Corp., 4. News Corp. Ltd., 5. Bertelsmann SE & Co. Im vergangenen Jahr 2016 war die Reihenfolge: 1. Alphabet Inc. (mit Google), 2. Comcast Corp., 3. Walt Disney Comp., 4. News Corp., 5. AT&T Entertainment Group. Apple liegt auf Platz 9, Facebook auf Platz 13. Bertels-mann ist auf Platz 11 abgerutscht. Das Buch von Lutz Hachmeister und Till Wäscher über die fünfzig größten Medien- und Wissenskonzerne ist beeindruckend in der Faktensammlung und lesenswert dank der konkreten Texte. Auf insgesamt 460 Seiten wird jeder Konzern mit einem kurzen Überblick vorgestellt, mit seinen Basisdaten und dem verantwortlichen Management, dann folgen Texte zu Geschichte und Profil, zu Geschäftsfeldern und aktueller Entwicklung. Ein Einleitungstext der Herausgeber reflektiert über die aktuelle Bedeutung der Wissens- und Datenkonzerne, ein zweiter Text – von Lutz Hachmeister – erinnert an die Situation 2005: „Die Kulturen der Medienkonzerne“. Unter den Konzernporträts fand ich Time Warner, Sony, Apple, Vivendi, Microsoft, BBC und ARD (Plätze 28 und 29), Netflix, Amazon (Platz 33), Yahoo und Nintendo besonders interessant. Über die Plätze 51 bis 100 informiert eine spezielle Tabelle. Springer liegt auf Platz 52, ProSiebenSAT1 auf 53, Bauer Media auf 71, Hubert Burda auf 72, das ZDF auf 74, Georg von Holtzbrinck auf 83. Und natürlich gibt es Konzerne auch in China, Indien, Skandinavien oder Großbritannien. Man kann beim Lesen auf eigenen Wegen die Welt durchqueren. Und macht sich am Ende Gedanken, wie die Situation in zehn Jahren sein wird. Erschienen im Herbert von Halem Verlag. Mehr zum Buch: wer-beherrscht-die-medien/
11. Juli 2017
Hollywood erzählt Mythen
 Für junge, unerfahrene Autorinnen und Autoren enthüllt Jürgen Moh-ring, Absolvent der Filmhochschule in Babelsberg, „Das Geheimnis erfolgreicher Liebesgeschichten“, die Kraft der Mythen. Es geht um zwanzig mythische Themen (zum Beispiel verbotene Liebe, Obses-sion, Trennungsduell, die zweite Chance, schwierige Partnerwahl, den Geliebten in Not zu retten), um mythische Figuren, Motivations-mythen, mythische Eigenschaften, mythische Handlungen, mythische Gegenstände, mythische Orte und am Ende um das mythische Erzähl-modell. In Struktur und Sprache ein Lehrbuch. Am Ende jedes Unterkapitels wird auf Filmbeispiele verwiesen. Die 113 Filmtitel schlagen einen zeitlichen Bogen von 1930 (DER BLAUE ENGEL) bis 2015 (FIFTY SHADES OF GREY). Im Schlusswort steht der Satz „Mythen sind vor allem Geschichten, die sich bewährt haben.“ Sieben Bücher werden als weiterführende Literatur empfohlen, darunter die „Poetik“ des Aristoteles, die Bibel in der Übersetzung von Martin Luther und „Das Drehbuch“ von Syd Field. So ein Buch/Text lebt offenbar von Reduktionen. Mehr zum Buch: mythen-paperback-89676/
Für junge, unerfahrene Autorinnen und Autoren enthüllt Jürgen Moh-ring, Absolvent der Filmhochschule in Babelsberg, „Das Geheimnis erfolgreicher Liebesgeschichten“, die Kraft der Mythen. Es geht um zwanzig mythische Themen (zum Beispiel verbotene Liebe, Obses-sion, Trennungsduell, die zweite Chance, schwierige Partnerwahl, den Geliebten in Not zu retten), um mythische Figuren, Motivations-mythen, mythische Eigenschaften, mythische Handlungen, mythische Gegenstände, mythische Orte und am Ende um das mythische Erzähl-modell. In Struktur und Sprache ein Lehrbuch. Am Ende jedes Unterkapitels wird auf Filmbeispiele verwiesen. Die 113 Filmtitel schlagen einen zeitlichen Bogen von 1930 (DER BLAUE ENGEL) bis 2015 (FIFTY SHADES OF GREY). Im Schlusswort steht der Satz „Mythen sind vor allem Geschichten, die sich bewährt haben.“ Sieben Bücher werden als weiterführende Literatur empfohlen, darunter die „Poetik“ des Aristoteles, die Bibel in der Übersetzung von Martin Luther und „Das Drehbuch“ von Syd Field. So ein Buch/Text lebt offenbar von Reduktionen. Mehr zum Buch: mythen-paperback-89676/
09. Juli 2017
DER REST IST SCHWEIGEN (1959)
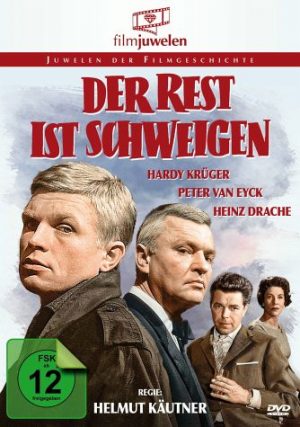 „frei nach motiven aus shake-speares ‚hamlet’“, heißt es im Vorspann. Helmut Käutner hat sich aus dem Drama personale Konstellationen und spezifische Handlungselemente geholt, und der Titel zitiert die letzten Worte des Helden. Käutners Hamlet-Figur bleibt allerdings am Leben. Der Philosophie-Dozent John H. Claudius kehrt zu Beginn des Films am Ende der 1950er Jahre aus Amerika in seine Heimat Deutschland zurück. Er ist Erbe der Claudius-Stahlhütte, sein Vater soll bei Kriegsende von einem Bombenangriff getötet worden sein. Aber John vermutet, dass ihn sein Onkel Paul umgebracht hat. Seine Mutter Gertrud hat inzwischen Paul geheiratet. John versucht mit allen Möglichkeiten, den Mord an seinem Vater zu beweisen. Ophelia heißt hier Fee, ist Tochter eines Arztes und wohnt in einem Blumenhaus. Sie wird am Ende in die Psychiatrie gebracht. Eigentlich hatte sich Käutner Montgomery Clift, Gustaf Gründgens und Marlene Dietrich für die Hauptrollen erhofft, aber das hat dann nicht geklappt. Hardy Krüger spielt den Heimkehrer John mit großer Verve, Peter van Eyck und Adelheid Seeck agieren als Paul und Gertrud eher zurückhaltend, Ingrid Andree als Fee setzt vor allem auf die Wirkung ihrer Augen. Der Film ist ziemlich dialoglastig, obwohl Igor Oberberg beeindruckende Schwarzweiß-Bilder aus dem winterlichen Ruhrgebiet rund um die Gutehoffnungshütte aufgenommen hat. Die Claudius-Villa wurde von Herbert Kirchhoff und Albrecht Becker stilsicher gebaut und eingerichtet. Bei den Filmjuwelen ist jetzt eine DVD des Films erschienen. Mit einem informativen Booklet von Dominik Starck. Mehr zur DVD: 22filmjuwelen%22
„frei nach motiven aus shake-speares ‚hamlet’“, heißt es im Vorspann. Helmut Käutner hat sich aus dem Drama personale Konstellationen und spezifische Handlungselemente geholt, und der Titel zitiert die letzten Worte des Helden. Käutners Hamlet-Figur bleibt allerdings am Leben. Der Philosophie-Dozent John H. Claudius kehrt zu Beginn des Films am Ende der 1950er Jahre aus Amerika in seine Heimat Deutschland zurück. Er ist Erbe der Claudius-Stahlhütte, sein Vater soll bei Kriegsende von einem Bombenangriff getötet worden sein. Aber John vermutet, dass ihn sein Onkel Paul umgebracht hat. Seine Mutter Gertrud hat inzwischen Paul geheiratet. John versucht mit allen Möglichkeiten, den Mord an seinem Vater zu beweisen. Ophelia heißt hier Fee, ist Tochter eines Arztes und wohnt in einem Blumenhaus. Sie wird am Ende in die Psychiatrie gebracht. Eigentlich hatte sich Käutner Montgomery Clift, Gustaf Gründgens und Marlene Dietrich für die Hauptrollen erhofft, aber das hat dann nicht geklappt. Hardy Krüger spielt den Heimkehrer John mit großer Verve, Peter van Eyck und Adelheid Seeck agieren als Paul und Gertrud eher zurückhaltend, Ingrid Andree als Fee setzt vor allem auf die Wirkung ihrer Augen. Der Film ist ziemlich dialoglastig, obwohl Igor Oberberg beeindruckende Schwarzweiß-Bilder aus dem winterlichen Ruhrgebiet rund um die Gutehoffnungshütte aufgenommen hat. Die Claudius-Villa wurde von Herbert Kirchhoff und Albrecht Becker stilsicher gebaut und eingerichtet. Bei den Filmjuwelen ist jetzt eine DVD des Films erschienen. Mit einem informativen Booklet von Dominik Starck. Mehr zur DVD: 22filmjuwelen%22
07. Juli 2017
Disneys Welt
 Richard Schickel war von 1965 bis 2009 Filmkritiker des Time magazine und hat Biografien über D. W. Griffith, Marlon Brando, Clint Eastwood und Elia Kazan publiziert. Sein erstes Buch erschien 1968: „The Disney Version. The Life, Times, Art and Commerce of Walt Disney“, eine sehr sachkundige aber auch kritische Publikation über den Erfinder von Mickey Mouse und Donald Duck, den Produzenten weltweit erfolgreicher Anima-tionsfilme und den Gründer von Disneyland in Anaheim und Orlando. Walt Disney war zwei Jahre zuvor im Alter von 65 Jahren an Lungenkrebs gestorben. 1997 erschien Schickels Buch in einer Neuauflage, die erstmals auch ins Deutsche übersetzt und vom Kadmos Verlag publiziert wurde. Nach zwanzig Jahren ist das inzwischen vergriffene Buch wieder präsent, und das ist sehr zu begrüßen. Die elf Kapitel haben die vielver-sprechenden Überschriften „Eine vorläufige Bilanz“, „Das Land, das Disney prägte“, „Von Kansas City nach Los Angeles“, „Zurück an den Zeichentisch“, „Eine Maus kommt zur Welt“, „Jeder wird einmal erwachsen“, „Disneys Torheit“, „Wirre Zeiten“, „Die lange Pause“, „Disneys Land“, „Eine Schlußbilanz“. Disneys Lebens-geschichte wird vom Autor eng verknüpft mit künstlerischen, ökonomischen, sozialen und politischen Fakten, so dass ein Panorama der Zeit und der amerikanischen Filmgeschichte entsteht, in dem die Hauptfigur sehr differenziert dargestellt wird. Auch die zahllosen von Disney produzierten Filme werden von Schickel unterschiedlich bewertet. Ein sehr lesenswertes Buch. Der Autor Richard Schickel ist im Februar 2017 in Los Angeles gestorben. Coverfoto: Walt Disney und Wernher von Braun. Mehr zum Buch: disneys-welt-4576.html
Richard Schickel war von 1965 bis 2009 Filmkritiker des Time magazine und hat Biografien über D. W. Griffith, Marlon Brando, Clint Eastwood und Elia Kazan publiziert. Sein erstes Buch erschien 1968: „The Disney Version. The Life, Times, Art and Commerce of Walt Disney“, eine sehr sachkundige aber auch kritische Publikation über den Erfinder von Mickey Mouse und Donald Duck, den Produzenten weltweit erfolgreicher Anima-tionsfilme und den Gründer von Disneyland in Anaheim und Orlando. Walt Disney war zwei Jahre zuvor im Alter von 65 Jahren an Lungenkrebs gestorben. 1997 erschien Schickels Buch in einer Neuauflage, die erstmals auch ins Deutsche übersetzt und vom Kadmos Verlag publiziert wurde. Nach zwanzig Jahren ist das inzwischen vergriffene Buch wieder präsent, und das ist sehr zu begrüßen. Die elf Kapitel haben die vielver-sprechenden Überschriften „Eine vorläufige Bilanz“, „Das Land, das Disney prägte“, „Von Kansas City nach Los Angeles“, „Zurück an den Zeichentisch“, „Eine Maus kommt zur Welt“, „Jeder wird einmal erwachsen“, „Disneys Torheit“, „Wirre Zeiten“, „Die lange Pause“, „Disneys Land“, „Eine Schlußbilanz“. Disneys Lebens-geschichte wird vom Autor eng verknüpft mit künstlerischen, ökonomischen, sozialen und politischen Fakten, so dass ein Panorama der Zeit und der amerikanischen Filmgeschichte entsteht, in dem die Hauptfigur sehr differenziert dargestellt wird. Auch die zahllosen von Disney produzierten Filme werden von Schickel unterschiedlich bewertet. Ein sehr lesenswertes Buch. Der Autor Richard Schickel ist im Februar 2017 in Los Angeles gestorben. Coverfoto: Walt Disney und Wernher von Braun. Mehr zum Buch: disneys-welt-4576.html