26. November 2017
11 Berliner Friedhöfe
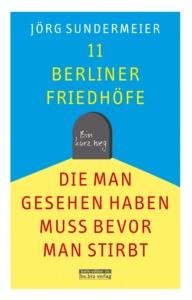 Heute ist Totensonntag. Das soll der Anlass sein, ausnahmsweise keine DVD zu rezensieren, son-dern ein Buch von Jörg Sunder-meier vorzustellen: „11 Berliner Friedhöfe, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt“ (mit Fotografien von Kristine Listau), erschienen im be.bra Verlag. Dies ist die Auswahl des Autors: Doro-theenstädtischer Friedhof (wo Prominenz ruht), Künstlerfried-hof Friedenau (wo Entdeckungen zu machen sind), Invaliden-friedhof (wo Preußen zu sich selbst kommt), Sowjetisches Ehrenmal (wo Menschen Helden sind), Friedhöfe an der Bergmannstraße (wo Vergessene auf Ewigkeit pochen), Urnenfriedhof Gericht-straße (wo Asche für den Fortschritt steht), Frauenfriedhof (wo Lesben ihre Ruhe haben), Jüdischer Friedhof Weißensee (wo das Leben schläft), Türkischer Friedhof am Columbiadamm (wo der Islam zu Deutschland gehört), Friedhöfe vor dem Halleschen Tor (wo Tote gefeiert werden) und Friedhöfe an der Hermannstraße (wo die Arbeit am Tod sichtbar ist). Die Auswahl war für den Autor schwierig, er nennt selbst am Ende einige Friedhöfe, die wirklich fehlen. Ich vermisse zum Beispiel den Friedhof an der Heerstraße (Michael Althen, Horst Buchholz, Wolf Donner, Dietrich Fischer-Dieskau, Loriot, Heinz Rathsack), die Waldfriedhöfe in Zehlendorf (Willy Brandt und Ernst Reuter, Helmut Käutner, Wolfgang Menge, Hildegard Knef) und in Dahlem (Michael Ballhaus, Friedrich Luft, Richard von Weizsäcker). Mit diesen Friedhöfen sind viele persönliche Erinnerungen verbunden. Vor 22 Jahren habe ich mit Antje im tip einen Text über Berliner Friedhöfe veröffentlicht (novembertage-2/ ). Das Buch von Jörg Sundermeier ist lesenswert, verliert sich gelegentlich zu sehr in einzelnen Biografien, vermittelt aber viel von der speziellen Bedeutung der elf ausgewählten Friedhöfe. Mehr zum Buch: bevor-man-stirbt.html
Heute ist Totensonntag. Das soll der Anlass sein, ausnahmsweise keine DVD zu rezensieren, son-dern ein Buch von Jörg Sunder-meier vorzustellen: „11 Berliner Friedhöfe, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt“ (mit Fotografien von Kristine Listau), erschienen im be.bra Verlag. Dies ist die Auswahl des Autors: Doro-theenstädtischer Friedhof (wo Prominenz ruht), Künstlerfried-hof Friedenau (wo Entdeckungen zu machen sind), Invaliden-friedhof (wo Preußen zu sich selbst kommt), Sowjetisches Ehrenmal (wo Menschen Helden sind), Friedhöfe an der Bergmannstraße (wo Vergessene auf Ewigkeit pochen), Urnenfriedhof Gericht-straße (wo Asche für den Fortschritt steht), Frauenfriedhof (wo Lesben ihre Ruhe haben), Jüdischer Friedhof Weißensee (wo das Leben schläft), Türkischer Friedhof am Columbiadamm (wo der Islam zu Deutschland gehört), Friedhöfe vor dem Halleschen Tor (wo Tote gefeiert werden) und Friedhöfe an der Hermannstraße (wo die Arbeit am Tod sichtbar ist). Die Auswahl war für den Autor schwierig, er nennt selbst am Ende einige Friedhöfe, die wirklich fehlen. Ich vermisse zum Beispiel den Friedhof an der Heerstraße (Michael Althen, Horst Buchholz, Wolf Donner, Dietrich Fischer-Dieskau, Loriot, Heinz Rathsack), die Waldfriedhöfe in Zehlendorf (Willy Brandt und Ernst Reuter, Helmut Käutner, Wolfgang Menge, Hildegard Knef) und in Dahlem (Michael Ballhaus, Friedrich Luft, Richard von Weizsäcker). Mit diesen Friedhöfen sind viele persönliche Erinnerungen verbunden. Vor 22 Jahren habe ich mit Antje im tip einen Text über Berliner Friedhöfe veröffentlicht (novembertage-2/ ). Das Buch von Jörg Sundermeier ist lesenswert, verliert sich gelegentlich zu sehr in einzelnen Biografien, vermittelt aber viel von der speziellen Bedeutung der elf ausgewählten Friedhöfe. Mehr zum Buch: bevor-man-stirbt.html
25. November 2017
Rosa von Praunheim 75
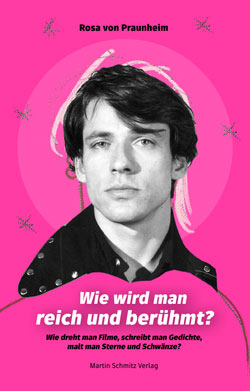 Heute wird der Filmemacher Rosa von Praunheim, mit dem ich seit über zwanzig Jahren befreundet bin, 75 Jahre alt. Er feiert das mit dem gerade publi-zierten Buch „Wie wird man reich und berühmt?“ und mit dem Kinostart seines neuen Films ÜBERLEBEN IN NEUKÖLLN, er wird gefeiert mit der Ausstrah-lung verschiedener Filme im Dritten Programm des rbb (HÄRTE morgen am späten Abend), des WDR (ROSA-KINDER am 27. November), auf arte (DER EINSTEIN DES SEX und HÄRTE am 29. November). In seinem Buch beantwortet er viele Fragen, zum Beispiel: „Wie dreht man Filme, schreibt man Gedichte, malt man Sterne und Schwänze?“ Rosa hat weit über 100 Filme gedreht, zwischendurch war er einige Jahre Professor an der HFF in Babelsberg, sein Buch richtet sich vor allem an junge Menschen, die Filme machen wollen. Ihnen gibt er konkrete Ratschläge, zum Beispiel: Nimm alles persönlich! Sieh in den Spiegel! Schreibe jeden Morgen ein Gedicht! Sei ein Voyeur! Mach alles selbst! Er beantwortet immer wieder Fragen: Was ist eine Geschichte? Wie funktioniert Spannung? Wie führt man Schauspieler*innen? Es geht um Dokumentarfilm und Spielfilm, um Emotion und große Gefühle, um Handlung und Action, um Filme mit und ohne Geld, um erste und letzte Schritte. Viele Ratschläge finde ich gut und originell, manche auch falsch, aber das macht nichts, denn das Buch ist nicht systematisch strukturiert, sondern so assoziativ geschrieben, dass kleine Aussetzer schnell zu überlesen sind. Gegen Ende gibt es eine kurze Autobio von Rosa, Hinweise auf ungedrehte Filme von ihm und schließlich sechs Interviews: mit Tom Tykwer, Axel Ranisch, Julia von Heinz, Wolfgang Kirchner, Nico Hofmann und Charlotte Siebenrock. Mit vielen Zeichnungen, Fotos und Gedichten. Coverfoto: Rosa, als er noch etwas jünger war. Herzlichen Glückwunsch, Rosa, und bleib noch lange in dieser Welt! Mehr zum Buch: Praunheim/Buch.html
Heute wird der Filmemacher Rosa von Praunheim, mit dem ich seit über zwanzig Jahren befreundet bin, 75 Jahre alt. Er feiert das mit dem gerade publi-zierten Buch „Wie wird man reich und berühmt?“ und mit dem Kinostart seines neuen Films ÜBERLEBEN IN NEUKÖLLN, er wird gefeiert mit der Ausstrah-lung verschiedener Filme im Dritten Programm des rbb (HÄRTE morgen am späten Abend), des WDR (ROSA-KINDER am 27. November), auf arte (DER EINSTEIN DES SEX und HÄRTE am 29. November). In seinem Buch beantwortet er viele Fragen, zum Beispiel: „Wie dreht man Filme, schreibt man Gedichte, malt man Sterne und Schwänze?“ Rosa hat weit über 100 Filme gedreht, zwischendurch war er einige Jahre Professor an der HFF in Babelsberg, sein Buch richtet sich vor allem an junge Menschen, die Filme machen wollen. Ihnen gibt er konkrete Ratschläge, zum Beispiel: Nimm alles persönlich! Sieh in den Spiegel! Schreibe jeden Morgen ein Gedicht! Sei ein Voyeur! Mach alles selbst! Er beantwortet immer wieder Fragen: Was ist eine Geschichte? Wie funktioniert Spannung? Wie führt man Schauspieler*innen? Es geht um Dokumentarfilm und Spielfilm, um Emotion und große Gefühle, um Handlung und Action, um Filme mit und ohne Geld, um erste und letzte Schritte. Viele Ratschläge finde ich gut und originell, manche auch falsch, aber das macht nichts, denn das Buch ist nicht systematisch strukturiert, sondern so assoziativ geschrieben, dass kleine Aussetzer schnell zu überlesen sind. Gegen Ende gibt es eine kurze Autobio von Rosa, Hinweise auf ungedrehte Filme von ihm und schließlich sechs Interviews: mit Tom Tykwer, Axel Ranisch, Julia von Heinz, Wolfgang Kirchner, Nico Hofmann und Charlotte Siebenrock. Mit vielen Zeichnungen, Fotos und Gedichten. Coverfoto: Rosa, als er noch etwas jünger war. Herzlichen Glückwunsch, Rosa, und bleib noch lange in dieser Welt! Mehr zum Buch: Praunheim/Buch.html
24. November 2017
Josef Hader
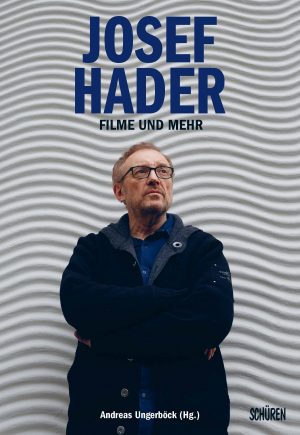 Mit zwei Filmen hat er in jüng-ster Zeit Aufsehen erregt: als Darsteller des Schriftstellers Stefan Zweig in Maria Schra-ders VOR DER MORGENRÖTE und des Musikkritikers Georg in dem von ihm inszenierten Film WILDE MAUS. Josef Hader (*1962) ist als Kabarettist, Schauspieler, Autor und nun auch Regisseur vor allem in Österreich sehr populär. Mehr-fach hat er den Privatdetektiv Simon Brenner in den Verfil-mungen der Romane von Wolf Haas gespielt. Im Schüren Verlag ist jetzt ein sehr liebevoll gestaltetes Buch über ihn erschienen, das Andreas Ungerböck herausgegeben hat. Von Haders Kollegin Maria Hofstätter stammt ein kurzes Vorwort. Der Herausgeber Ungerböck porträtiert den Schauspieler in einem klugen Essay. Er hat auch ein sehr reflektiertes Gespräch mit ihm geführt. Michael Pekler charakterisiert in seinem Text die Rollen, die Hader verkörpert. Auf 20 Seiten sind dann Filmstills und Porträts dokumentiert, weitere Abbildungen sind über das Buch verteilt. Seine persönlichen Erfahrungen mit Josef Hader vermittelt sein Agent Georg Hoanzl in einem Gespräch. Die Schriftstellerin Doris Knecht erzählt über Haders Präsenz im Kabarett und im Kino. Eine sehr präzise Filmografie schließt den Band ab, in dem Josef Hader angemessen gewürdigt wird. Mehr zum Buch: 556-josef-hader.html
Mit zwei Filmen hat er in jüng-ster Zeit Aufsehen erregt: als Darsteller des Schriftstellers Stefan Zweig in Maria Schra-ders VOR DER MORGENRÖTE und des Musikkritikers Georg in dem von ihm inszenierten Film WILDE MAUS. Josef Hader (*1962) ist als Kabarettist, Schauspieler, Autor und nun auch Regisseur vor allem in Österreich sehr populär. Mehr-fach hat er den Privatdetektiv Simon Brenner in den Verfil-mungen der Romane von Wolf Haas gespielt. Im Schüren Verlag ist jetzt ein sehr liebevoll gestaltetes Buch über ihn erschienen, das Andreas Ungerböck herausgegeben hat. Von Haders Kollegin Maria Hofstätter stammt ein kurzes Vorwort. Der Herausgeber Ungerböck porträtiert den Schauspieler in einem klugen Essay. Er hat auch ein sehr reflektiertes Gespräch mit ihm geführt. Michael Pekler charakterisiert in seinem Text die Rollen, die Hader verkörpert. Auf 20 Seiten sind dann Filmstills und Porträts dokumentiert, weitere Abbildungen sind über das Buch verteilt. Seine persönlichen Erfahrungen mit Josef Hader vermittelt sein Agent Georg Hoanzl in einem Gespräch. Die Schriftstellerin Doris Knecht erzählt über Haders Präsenz im Kabarett und im Kino. Eine sehr präzise Filmografie schließt den Band ab, in dem Josef Hader angemessen gewürdigt wird. Mehr zum Buch: 556-josef-hader.html
21. November 2017
Regina Ziegler
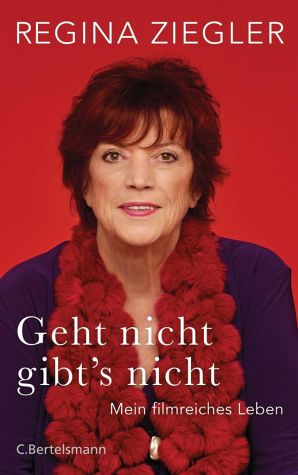 Sie ist die erfolgreichste deut-sche Produzentin, hat an die hundert Kinofilme und über zweihundert Fernsehfilme und Serien auf den Weg gebracht, sie wurde international vielfach ausgezeichnet und engagiert sich, wenn es ihr notwendig erscheint. Regina Ziegler (*1944) hat jetzt ihre Autobiografie publiziert: „Geht nicht gibt’s nicht“. Das ist der Satz, den ihr langjähriger Ehemann, der Filmregisseur Wolf Gremm, ihr als Lebensmotto vorgegeben hat. Das Buch ist mit großer Empathie geschrieben, es erzählt von Erfolgen, aber auch von Niederlagen, die für sie wohl schlimmste war der Misserfolg ihres Herzensprojekts HENRY 4, die Verfilmung der beiden Romane von Heinrich Mann in der Regie von Jo Baier (2010). Es überwiegen jedoch die Erfolgsmeldungen: wenn die Finanzierung geklappt hat, die Zusammenarbeit mit Regisseurinnen oder Regisseuren zu guten Ergebnissen führte, das Publikum und die Kritik positiv reagierte. Besonders spannend fand ich die Kapitel über den Film SOMMERGÄSTE, den Regisseur Andrzej Wajda, die Episodenfilme EROTIC TALES, die Organisation der Deutschen Filmpreis-Verleihung in den 1990er Jahren, die Realisierung der Serie WEISSENSEE. Natürlich spielen die Filme ihres Mannes Wolf Gremm eine wichtige Rolle im Buch, speziell KAMIKAZE 1989 mit Rainer Werner Fassbinder in der Hauptrolle. Bewegend erzählt Regina Ziegler von der Zeit, in der Wolf gegen seine Krebserkrankung gekämpft hat; er ist im Juli 2015 gestorben. Das Buch erlaubt einen Blick hinter die Kulissen der Film- und Fernsehbranche, die sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert hat. Die Autorin jammert darüber nicht, sie hat ja auch, ihrem Lebensmotto folgend, meist eine positive Lösung der Probleme gefunden. Dafür kann man sie durchaus bewundern. Bei der Formulierung der Autobiografie wurde Regina Ziegler von Andrea Stoll unterstützt. Mit 32 Bildseiten am Ende des Bandes. Mehr zum Buch: e510125.rhd
Sie ist die erfolgreichste deut-sche Produzentin, hat an die hundert Kinofilme und über zweihundert Fernsehfilme und Serien auf den Weg gebracht, sie wurde international vielfach ausgezeichnet und engagiert sich, wenn es ihr notwendig erscheint. Regina Ziegler (*1944) hat jetzt ihre Autobiografie publiziert: „Geht nicht gibt’s nicht“. Das ist der Satz, den ihr langjähriger Ehemann, der Filmregisseur Wolf Gremm, ihr als Lebensmotto vorgegeben hat. Das Buch ist mit großer Empathie geschrieben, es erzählt von Erfolgen, aber auch von Niederlagen, die für sie wohl schlimmste war der Misserfolg ihres Herzensprojekts HENRY 4, die Verfilmung der beiden Romane von Heinrich Mann in der Regie von Jo Baier (2010). Es überwiegen jedoch die Erfolgsmeldungen: wenn die Finanzierung geklappt hat, die Zusammenarbeit mit Regisseurinnen oder Regisseuren zu guten Ergebnissen führte, das Publikum und die Kritik positiv reagierte. Besonders spannend fand ich die Kapitel über den Film SOMMERGÄSTE, den Regisseur Andrzej Wajda, die Episodenfilme EROTIC TALES, die Organisation der Deutschen Filmpreis-Verleihung in den 1990er Jahren, die Realisierung der Serie WEISSENSEE. Natürlich spielen die Filme ihres Mannes Wolf Gremm eine wichtige Rolle im Buch, speziell KAMIKAZE 1989 mit Rainer Werner Fassbinder in der Hauptrolle. Bewegend erzählt Regina Ziegler von der Zeit, in der Wolf gegen seine Krebserkrankung gekämpft hat; er ist im Juli 2015 gestorben. Das Buch erlaubt einen Blick hinter die Kulissen der Film- und Fernsehbranche, die sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert hat. Die Autorin jammert darüber nicht, sie hat ja auch, ihrem Lebensmotto folgend, meist eine positive Lösung der Probleme gefunden. Dafür kann man sie durchaus bewundern. Bei der Formulierung der Autobiografie wurde Regina Ziegler von Andrea Stoll unterstützt. Mit 32 Bildseiten am Ende des Bandes. Mehr zum Buch: e510125.rhd
19. November 2017
GARTEN DES BÖSEN (1954)
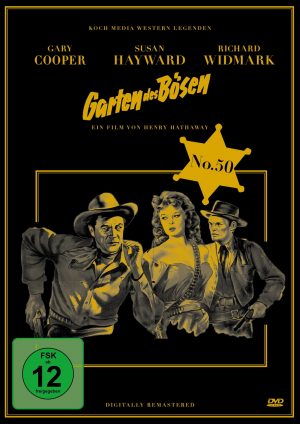 2010 erschien bei Koch Media die erste DVD in der Edition „Western Legenden“, es war der Film WHITE FEATHER von Robert D. Webb, jetzt ist die Nr. 50 erreicht: GARDEN OF EVIL (1954) von Henry Hathaway. Man findet in der Reihe bekann-te und unbekannte Titel dieses Genres, die Kontinuität verdient allen Respekt. – „Garten des Bösen“ nennen die Indianer einen ihnen heiligen Bereich, in dem sich auch eine Goldmine befindet. Dort wurde der Gold-gräber John Fuller verschüttet. Seine Frau Leah holt Hilfe in einem mexikanischen Fischerdorf. Vier Männer – Hooker, Fiske, Daly und Vincente – lassen sich gegen eine versprochene Belohnung auf die Rettungsaktion ein. Sie finden den Verschütteten, bergen ihn verletzt und machen sich auf den Weg zurück. Indianer folgen ihnen bedrohlich. Zuerst wird Daly von einem Pfeil getötet, John gibt plötzlich auf, dann verliert Vincente die Nerven und wird umgebracht. In einem Engpass muss einer der beiden Männer den Rückzug der anderen decken. Fiske verliert, als die Rolle ausgelost wird. Hooker und Leah entkommen. Beeindruckend sind zunächst einmal die Darsteller/innen: Susan Hayward als Leah, Gary Cooper als Hooker, Richard Widmark als Fiske, Cameron Mitchell als Daly, Victor Manuel Mendoza als Vincente, Hugh Marlowe als John. Hathaway wagt grausame Szenen, gedreht wurde im Scope-Format, hinter der Kamera stand Milton Krasner, die Musik komponierte Bernard Hermann. Das Filmmaterial wurde für DVD und Blu-ray remastered, es gibt umfangreiches Bonusmaterial: einen Audiokommentar, ein Making of, Featurettes über Susan Hayward und Henry Hathaway und ein Booklet von Richard Oehmann. Für die Nr. 50 der „Western Legenden“ angemessen. Mehr zur DVD: western_legenden_50_dvd/
2010 erschien bei Koch Media die erste DVD in der Edition „Western Legenden“, es war der Film WHITE FEATHER von Robert D. Webb, jetzt ist die Nr. 50 erreicht: GARDEN OF EVIL (1954) von Henry Hathaway. Man findet in der Reihe bekann-te und unbekannte Titel dieses Genres, die Kontinuität verdient allen Respekt. – „Garten des Bösen“ nennen die Indianer einen ihnen heiligen Bereich, in dem sich auch eine Goldmine befindet. Dort wurde der Gold-gräber John Fuller verschüttet. Seine Frau Leah holt Hilfe in einem mexikanischen Fischerdorf. Vier Männer – Hooker, Fiske, Daly und Vincente – lassen sich gegen eine versprochene Belohnung auf die Rettungsaktion ein. Sie finden den Verschütteten, bergen ihn verletzt und machen sich auf den Weg zurück. Indianer folgen ihnen bedrohlich. Zuerst wird Daly von einem Pfeil getötet, John gibt plötzlich auf, dann verliert Vincente die Nerven und wird umgebracht. In einem Engpass muss einer der beiden Männer den Rückzug der anderen decken. Fiske verliert, als die Rolle ausgelost wird. Hooker und Leah entkommen. Beeindruckend sind zunächst einmal die Darsteller/innen: Susan Hayward als Leah, Gary Cooper als Hooker, Richard Widmark als Fiske, Cameron Mitchell als Daly, Victor Manuel Mendoza als Vincente, Hugh Marlowe als John. Hathaway wagt grausame Szenen, gedreht wurde im Scope-Format, hinter der Kamera stand Milton Krasner, die Musik komponierte Bernard Hermann. Das Filmmaterial wurde für DVD und Blu-ray remastered, es gibt umfangreiches Bonusmaterial: einen Audiokommentar, ein Making of, Featurettes über Susan Hayward und Henry Hathaway und ein Booklet von Richard Oehmann. Für die Nr. 50 der „Western Legenden“ angemessen. Mehr zur DVD: western_legenden_50_dvd/
18. November 2017
Zwischen Propaganda und Unterhaltung
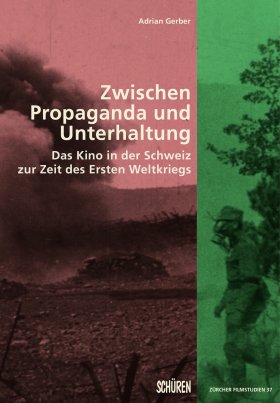 Eine Dissertation, die an der Universität Zürich entstanden ist. Adrian Gerber beschäftigt sich mit dem Kino in der Schweiz zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Durch seine Neutralität war dieses Land in der speziellen Lage, selbst keine Filme produzieren zu müssen, die den Krieg propagierten, anderseits wurde es von den entsprechen-den Filmen der Mittelmächte und der Alliierten überschwemmt. Das führte beim Publikum zu dem Wunsch, die eigene nationale Filmproduktion zu stärken. Zwei generelle Kapitel leiten das Buch ein, sie handeln von der Kinoöffentlichkeit und beschreiben Kinokultur und Filmmarkt zwischen 1900 und 1920. Das Hauptkapitel thematisiert „Kriegsfilme und Propagandakonzepte“, die „Organisation ausländischer Propaganda und die Reaktionen in der Schweiz“, die „Öffentliche Auseinandersetzungen mittels Filmen und über Filme“, die „Feindbilder in Spielfilmen und versteckte Propaganda“, die „Filmischen Darstellungen von Kriegsgefangenschaft, Internierung und Flucht“, „Aktualitätenfilm und Authentizität“ sowie „Publikumsverhalten und Rezeptionsmodi“. In Fallstudien werden diese Themen jeweils konkretisiert. Hier stehen vor allem einzelne Filme im Mittelpunkt, zum Beispiel der französische Film PENDAISON PENDANT LE GUERRE ITALO-TURQUE /1911/12), der deutsche Film GRAF DOHNA UND SEINE MÖWE (1917), der amerikanische Film THE BATTLE CRY OF PEACE (1915), der Schweizer Film DIE DURCHREISE DER FRANZÖSISCHEN EVAKUIERTEN DURCH DIE SCHWEIZ (1918), der österreichisch-ungarische Film DIE 10. ISONZOSCHLACHT (1917) und der englische Film THE BATTLE OF THE SOMME (1916). Die Analysen wirken sehr präzise, das Buch insgesamt ist hervorragend recherchiert und hat auch als Beitrag zur Kriegsgeschichte Bestand. Mit Abbildungen. Mehr zum Buch: zwischen-propaganda-und-unterhaltung.html
Eine Dissertation, die an der Universität Zürich entstanden ist. Adrian Gerber beschäftigt sich mit dem Kino in der Schweiz zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Durch seine Neutralität war dieses Land in der speziellen Lage, selbst keine Filme produzieren zu müssen, die den Krieg propagierten, anderseits wurde es von den entsprechen-den Filmen der Mittelmächte und der Alliierten überschwemmt. Das führte beim Publikum zu dem Wunsch, die eigene nationale Filmproduktion zu stärken. Zwei generelle Kapitel leiten das Buch ein, sie handeln von der Kinoöffentlichkeit und beschreiben Kinokultur und Filmmarkt zwischen 1900 und 1920. Das Hauptkapitel thematisiert „Kriegsfilme und Propagandakonzepte“, die „Organisation ausländischer Propaganda und die Reaktionen in der Schweiz“, die „Öffentliche Auseinandersetzungen mittels Filmen und über Filme“, die „Feindbilder in Spielfilmen und versteckte Propaganda“, die „Filmischen Darstellungen von Kriegsgefangenschaft, Internierung und Flucht“, „Aktualitätenfilm und Authentizität“ sowie „Publikumsverhalten und Rezeptionsmodi“. In Fallstudien werden diese Themen jeweils konkretisiert. Hier stehen vor allem einzelne Filme im Mittelpunkt, zum Beispiel der französische Film PENDAISON PENDANT LE GUERRE ITALO-TURQUE /1911/12), der deutsche Film GRAF DOHNA UND SEINE MÖWE (1917), der amerikanische Film THE BATTLE CRY OF PEACE (1915), der Schweizer Film DIE DURCHREISE DER FRANZÖSISCHEN EVAKUIERTEN DURCH DIE SCHWEIZ (1918), der österreichisch-ungarische Film DIE 10. ISONZOSCHLACHT (1917) und der englische Film THE BATTLE OF THE SOMME (1916). Die Analysen wirken sehr präzise, das Buch insgesamt ist hervorragend recherchiert und hat auch als Beitrag zur Kriegsgeschichte Bestand. Mit Abbildungen. Mehr zum Buch: zwischen-propaganda-und-unterhaltung.html
16. November 2017
Zelluloid und Marmor
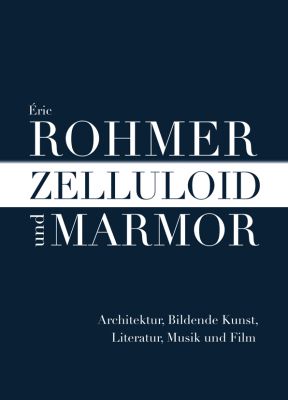 Éric Rohmer (eigentlich: Jean-Marie Maurice Schérer; 1920-2010) war nicht nur ein bedeu-tender Regisseur, sondern auch ein großer Theoretiker, der 1955 in fünf Essays in den Cahiers du cinéma die Besonderheiten des Films gegenüber dem Roman, der Malerei, der Lyrik, der Musik und der Architektur beschworen hat. Es galt als Manifest der Nouvelle Vague. 2009 führte Rohmer mit Noel Herpe und Philippe Fauvel sechs Gespräche, in denen er seine inzwischen historischen Texte aus heutiger Perspektive kommentierte und in einen aktuellen Zusammenhang stellte. Seine Sprache wirkt im Alter noch radikaler, auch wenn gelegentlich die Ironie ins Spiel kommt. In Frankreich ist das Buch „Le Celluloid et le Marbre“ 2010, kurz nach Rohmers Tod erschienen. Der Alexander Verlag hat jetzt eine deutsche Übersetzung publiziert, die uns die Bedeutung des Theoretikers Rohmer begreifen lässt. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang daran, dass er mit einer Dissertation über den Faustfilm von Friedrich Wilhelm Murnau 1972 in Paris promoviert wurde (den Text hat 1980 der Hanser veröffentlicht). Der Übersetzer Marcus Seibert hat zu „Zelluloid und Marmor“ ein kluges Nachwort geschrieben. Mehr zum Buch: erschienen&start=
Éric Rohmer (eigentlich: Jean-Marie Maurice Schérer; 1920-2010) war nicht nur ein bedeu-tender Regisseur, sondern auch ein großer Theoretiker, der 1955 in fünf Essays in den Cahiers du cinéma die Besonderheiten des Films gegenüber dem Roman, der Malerei, der Lyrik, der Musik und der Architektur beschworen hat. Es galt als Manifest der Nouvelle Vague. 2009 führte Rohmer mit Noel Herpe und Philippe Fauvel sechs Gespräche, in denen er seine inzwischen historischen Texte aus heutiger Perspektive kommentierte und in einen aktuellen Zusammenhang stellte. Seine Sprache wirkt im Alter noch radikaler, auch wenn gelegentlich die Ironie ins Spiel kommt. In Frankreich ist das Buch „Le Celluloid et le Marbre“ 2010, kurz nach Rohmers Tod erschienen. Der Alexander Verlag hat jetzt eine deutsche Übersetzung publiziert, die uns die Bedeutung des Theoretikers Rohmer begreifen lässt. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang daran, dass er mit einer Dissertation über den Faustfilm von Friedrich Wilhelm Murnau 1972 in Paris promoviert wurde (den Text hat 1980 der Hanser veröffentlicht). Der Übersetzer Marcus Seibert hat zu „Zelluloid und Marmor“ ein kluges Nachwort geschrieben. Mehr zum Buch: erschienen&start=
15. November 2017
Nonnen in Film und TV
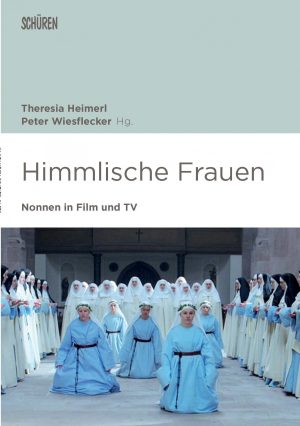 Ein interessantes Thema. Der erste Titel, der mir dazu immer einfällt, ist THE NUN’S STORY von Fred Zinnemann mit Audrey Hepburn. Das Buch dokumentiert die Referate eines Seminars, das im Institut für Religionswissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz stattgefunden hat. Acht Texte be-schäftigen sich mit „Himmlischen Frauen“. Peter Wiesflecker richtet seinen Blick auf „Nonnen im Histo-rienfilm und Historische Nonnen im Film“. Fred Zinnemanns Film ist dabei, aber auch SUZANNE SIMONIN, LA RELIGIEUSE DE DENISE DIDEROT von Jacques Rivette und LA PASSION DE BERNADETTE von Jean Delannoy. Theresia Heimerl beschäftigt sich mit Nonnen als Erzieherinnen, wichtige Filme sind in diesem Zusammenhang THE BELLS OF ST. MARY’S von Leo McCarey mit Ingrid Bergmann, THE MAGDALENE SISTERS von Peter Mullan mit Geraldine McEwan, DOUBT von John Patrick Shanley mit Meryl Streep und MARIE HEURTIN von Jean-Pierre Améris mit Isabelle Carré. Bei Christian Hatzenbichler geht es um „Detektivinnen im Ordensgewand“ vor allem in TV-Serien. Kathrin Trattner behandelt das heikle Thema der „Keuschen und unkeuschen Nonnen“ von BLACK NARCISSUS bis zum Nunsploitationfilm, einem Genre, das mir bisher eher unbekannt war. Lisa Kienzl informiert über „Die komödiale Inszenierung der Verkleidung als Nonne als besondere Darstellung des Sich-Versteckens und der Tarnung im Film“. Bei Kevin Reicher geht es um „Singende Nonnen“, und da denkt man zuerst an THE SOUND OF MUSIC, bei dem die Nonnen vor allem die Rahmenhandlung bilden. Der Bogen spannt sich dann zu SISTER ACT von Emile Ardolino bis zum Video ALEJANDRO von Lady Gaga. Matthias Steiner reflektiert über die besessenen Nonnen von Loudon im Films. Zum Abschluss untersuchen Ina Maria Holzer und Tina Riegelnegg die „Darstellung und Instrumentalisierung von Nonnen in Wirtschaftswerbungen“. Ein sehr lesenswertes Buch. Coverabbildung: LA RELIGIEUSE. Mehr zum Buch: himmlische-frauen-nonnen-in-film-und-tv.html
Ein interessantes Thema. Der erste Titel, der mir dazu immer einfällt, ist THE NUN’S STORY von Fred Zinnemann mit Audrey Hepburn. Das Buch dokumentiert die Referate eines Seminars, das im Institut für Religionswissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz stattgefunden hat. Acht Texte be-schäftigen sich mit „Himmlischen Frauen“. Peter Wiesflecker richtet seinen Blick auf „Nonnen im Histo-rienfilm und Historische Nonnen im Film“. Fred Zinnemanns Film ist dabei, aber auch SUZANNE SIMONIN, LA RELIGIEUSE DE DENISE DIDEROT von Jacques Rivette und LA PASSION DE BERNADETTE von Jean Delannoy. Theresia Heimerl beschäftigt sich mit Nonnen als Erzieherinnen, wichtige Filme sind in diesem Zusammenhang THE BELLS OF ST. MARY’S von Leo McCarey mit Ingrid Bergmann, THE MAGDALENE SISTERS von Peter Mullan mit Geraldine McEwan, DOUBT von John Patrick Shanley mit Meryl Streep und MARIE HEURTIN von Jean-Pierre Améris mit Isabelle Carré. Bei Christian Hatzenbichler geht es um „Detektivinnen im Ordensgewand“ vor allem in TV-Serien. Kathrin Trattner behandelt das heikle Thema der „Keuschen und unkeuschen Nonnen“ von BLACK NARCISSUS bis zum Nunsploitationfilm, einem Genre, das mir bisher eher unbekannt war. Lisa Kienzl informiert über „Die komödiale Inszenierung der Verkleidung als Nonne als besondere Darstellung des Sich-Versteckens und der Tarnung im Film“. Bei Kevin Reicher geht es um „Singende Nonnen“, und da denkt man zuerst an THE SOUND OF MUSIC, bei dem die Nonnen vor allem die Rahmenhandlung bilden. Der Bogen spannt sich dann zu SISTER ACT von Emile Ardolino bis zum Video ALEJANDRO von Lady Gaga. Matthias Steiner reflektiert über die besessenen Nonnen von Loudon im Films. Zum Abschluss untersuchen Ina Maria Holzer und Tina Riegelnegg die „Darstellung und Instrumentalisierung von Nonnen in Wirtschaftswerbungen“. Ein sehr lesenswertes Buch. Coverabbildung: LA RELIGIEUSE. Mehr zum Buch: himmlische-frauen-nonnen-in-film-und-tv.html
14. November 2017
Fiktive Werkgenesen
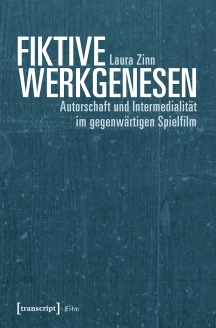 Eine Dissertation, die an der Universität Gießen entstanden ist. Laura Zinn beschäftigt sich darin mit „Autorschaft und Intermedialität im gegen-wärtigen Spielfilm“. Sie unter-sucht sechs Filme, die jeweils die Biografie eines Autors fiktionalisieren und daraus ein neues Werkverständnis generieren: SHAKESPEARE IN LOVE (1998) von John Madden mit Joseph Fiennes als Shake-speare (produziert von Harvey Weinstein); FINDING NEVER-LAND (2004, dt.: WENN TRÄUME FLIEGEN LERNEN) von Marc Forster mit Johnny Depp als „Peter Pan“-Autor James Matthew Barrie; THE LIBERTINE (2004) von Laurence Dunmore mit Johnny Depp als Schriftsteller John Wilmont; SCHILLER (2005) von Martin Weinhart mit Matthias Schweighöfer als Friedrich Schiller; MOLIÈRE (2007) von Laurent Tirard mit Romain Duris als Molière; ANONYMOUS (2011) von Roland Emmerich, der die These vertritt, dass William Shakespeares Werke von Edward de Vere stammen, der im Film von Rhys Ifans dargestellt wird. Die Einzelanalysen sind sehr konkret und präzise, der theoretische Rahmen entspricht den Vorgaben für eine Dissertation. Keine Abbildungen. Mehr zum Buch: fiktive-werkgenesen
Eine Dissertation, die an der Universität Gießen entstanden ist. Laura Zinn beschäftigt sich darin mit „Autorschaft und Intermedialität im gegen-wärtigen Spielfilm“. Sie unter-sucht sechs Filme, die jeweils die Biografie eines Autors fiktionalisieren und daraus ein neues Werkverständnis generieren: SHAKESPEARE IN LOVE (1998) von John Madden mit Joseph Fiennes als Shake-speare (produziert von Harvey Weinstein); FINDING NEVER-LAND (2004, dt.: WENN TRÄUME FLIEGEN LERNEN) von Marc Forster mit Johnny Depp als „Peter Pan“-Autor James Matthew Barrie; THE LIBERTINE (2004) von Laurence Dunmore mit Johnny Depp als Schriftsteller John Wilmont; SCHILLER (2005) von Martin Weinhart mit Matthias Schweighöfer als Friedrich Schiller; MOLIÈRE (2007) von Laurent Tirard mit Romain Duris als Molière; ANONYMOUS (2011) von Roland Emmerich, der die These vertritt, dass William Shakespeares Werke von Edward de Vere stammen, der im Film von Rhys Ifans dargestellt wird. Die Einzelanalysen sind sehr konkret und präzise, der theoretische Rahmen entspricht den Vorgaben für eine Dissertation. Keine Abbildungen. Mehr zum Buch: fiktive-werkgenesen
12. November 2017
ROBERT FRANK – DON’T BLINK (2015)
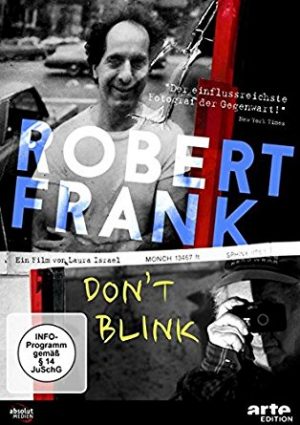 Robert Frank (*1924 in Zürich) ist einer der großen internatio-nalen Fotografen, der mit dem Buch „The Americans“ (1958) bekannt wurde. Sein Stil ist subjektiv, sozialkritisch und poetisch. Thomas Schadt hat 1988 den Dokumentarfilm DAS GEFÜHL DES AUGENBLICKS über ihn realisiert. Jetzt gibt es einen neuen Film, er stammt von Laura Israel und verbindet im Titel den Namen des Künst-lers mit der klassischen Auffor-derung beim Fotografieren, bitte nicht zu blinzeln. In einer Montage, die einen manchmal atemlos macht, wird das Leben von Robert Frank vor allem mit Fotos und Filmausschnitten erzählt. Er kommt selbst zu Wort, antwortet auf Fragen oft ironisch, ausweichend, mit seiner Gesprächspartnerin spielend. Laura Israel ist mit dem Werk Robert Franks bestens vertraut, sie war die Cutterin zahlreicher seiner Filme in den 1980er und 90er Jahren, denn Frank war nicht nur als Fotograf, sondern auch als dokumentarischer Filmemacher tätig. Die Materialfülle dieses Dokumentarfilms ist überwältigend. Wer bisher wenig oder nichts über Robert Frank weiß, könnte von der Flut an Bildern und Informationen leicht überfordert werden. Der Soundtrack leistet immerhin einige Hilfe bei der Verarbeitung. Man hört u.a. The Velvet Underground, The Kills und Bob Dylan. Eine 52-Minuten-Fassung des Films war im Juli auf arte zu sehen. Bei Absolut Medien ist jetzt die DVD mit der 82-Minuten-Originalfassung erschienen. Für alle Fans von Robert Frank schon so etwas wie ein Weihnachtsgeschenk… Mehr zur DVD: DON%27T+BLINK
Robert Frank (*1924 in Zürich) ist einer der großen internatio-nalen Fotografen, der mit dem Buch „The Americans“ (1958) bekannt wurde. Sein Stil ist subjektiv, sozialkritisch und poetisch. Thomas Schadt hat 1988 den Dokumentarfilm DAS GEFÜHL DES AUGENBLICKS über ihn realisiert. Jetzt gibt es einen neuen Film, er stammt von Laura Israel und verbindet im Titel den Namen des Künst-lers mit der klassischen Auffor-derung beim Fotografieren, bitte nicht zu blinzeln. In einer Montage, die einen manchmal atemlos macht, wird das Leben von Robert Frank vor allem mit Fotos und Filmausschnitten erzählt. Er kommt selbst zu Wort, antwortet auf Fragen oft ironisch, ausweichend, mit seiner Gesprächspartnerin spielend. Laura Israel ist mit dem Werk Robert Franks bestens vertraut, sie war die Cutterin zahlreicher seiner Filme in den 1980er und 90er Jahren, denn Frank war nicht nur als Fotograf, sondern auch als dokumentarischer Filmemacher tätig. Die Materialfülle dieses Dokumentarfilms ist überwältigend. Wer bisher wenig oder nichts über Robert Frank weiß, könnte von der Flut an Bildern und Informationen leicht überfordert werden. Der Soundtrack leistet immerhin einige Hilfe bei der Verarbeitung. Man hört u.a. The Velvet Underground, The Kills und Bob Dylan. Eine 52-Minuten-Fassung des Films war im Juli auf arte zu sehen. Bei Absolut Medien ist jetzt die DVD mit der 82-Minuten-Originalfassung erschienen. Für alle Fans von Robert Frank schon so etwas wie ein Weihnachtsgeschenk… Mehr zur DVD: DON%27T+BLINK