29. November 2020
VORSPIEL (1987)
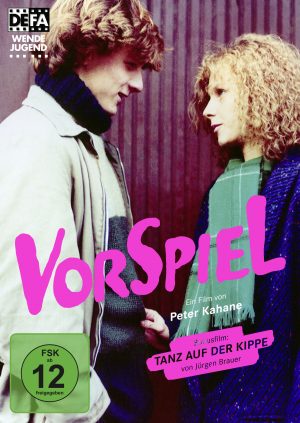 In einer kleinen Stadt in der DDR lässt sich der 17jährige Tom zum Dekorateur ausbilden. In seiner Clique gehört er zu den Schüchternen. Als die junge Corinna mit ihrem Vater, einem Museumsdirektor, aus Berlin in die Stadt zieht, wird sie zur Sehnsuchtsperson von Tom. Er hat viele Ideen, um ihr seine Zuneigung zu vermitteln. Toms Jugendfreundin Floh ist darüber sehr unglücklich. Corinna will sich als Schauspielerin ausbilden lassen. Wäre das nicht auch ein Beruf für Tom? Die beiden bereiten sich gemeinsam auf die Aufnahmeprüfung vor. Es gibt eine große Nähe, aber dann doch die Enttäuschung, dass Corinna den Anführer der Clique bevorzugt. Damit eröffnen sich Chancen für Floh, die sie auf wunderbare Weise nutzt. Der Film von Peter Kahane ist ein sensibles Coming-of-Age-Drama, es dominieren die Bilder über die Dialoge (Kamera: Andreas Köfer), Hendrik Duryn (Tom), Susanne Hoss (Corinna) und Antje Straßburger (Floh) spielen beeindruckend. In kleineren Rollen sind Hermann Beyer (Corinnas Vater) und Karin Schröder (Stadträtin) zu sehen. Bei Absolut Medien ist jetzt die DVD des Films erschienen. Zum Bonusmaterial gehört ein Audiokommentar von Peter Kahane und Ralf Schenk. Und es gibt als Bonusfilm TANZ AUF DER KIPPE (1991) von Jürgen Brauer mit Dagmar Manzel, Frank Stieren und Wilfried Glatzeder. Beide Filme sehr sehenswert. Mehr zur DVD: VORSPIEL+-+Bonusfilm+TANZ+AUF+DER+KIPPE
In einer kleinen Stadt in der DDR lässt sich der 17jährige Tom zum Dekorateur ausbilden. In seiner Clique gehört er zu den Schüchternen. Als die junge Corinna mit ihrem Vater, einem Museumsdirektor, aus Berlin in die Stadt zieht, wird sie zur Sehnsuchtsperson von Tom. Er hat viele Ideen, um ihr seine Zuneigung zu vermitteln. Toms Jugendfreundin Floh ist darüber sehr unglücklich. Corinna will sich als Schauspielerin ausbilden lassen. Wäre das nicht auch ein Beruf für Tom? Die beiden bereiten sich gemeinsam auf die Aufnahmeprüfung vor. Es gibt eine große Nähe, aber dann doch die Enttäuschung, dass Corinna den Anführer der Clique bevorzugt. Damit eröffnen sich Chancen für Floh, die sie auf wunderbare Weise nutzt. Der Film von Peter Kahane ist ein sensibles Coming-of-Age-Drama, es dominieren die Bilder über die Dialoge (Kamera: Andreas Köfer), Hendrik Duryn (Tom), Susanne Hoss (Corinna) und Antje Straßburger (Floh) spielen beeindruckend. In kleineren Rollen sind Hermann Beyer (Corinnas Vater) und Karin Schröder (Stadträtin) zu sehen. Bei Absolut Medien ist jetzt die DVD des Films erschienen. Zum Bonusmaterial gehört ein Audiokommentar von Peter Kahane und Ralf Schenk. Und es gibt als Bonusfilm TANZ AUF DER KIPPE (1991) von Jürgen Brauer mit Dagmar Manzel, Frank Stieren und Wilfried Glatzeder. Beide Filme sehr sehenswert. Mehr zur DVD: VORSPIEL+-+Bonusfilm+TANZ+AUF+DER+KIPPE
28. November 2020
UNDINE (2020)
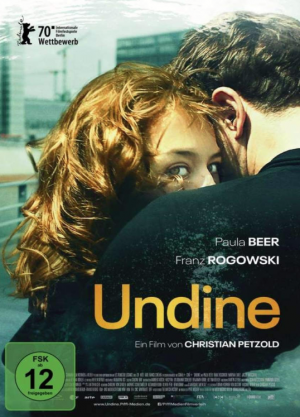 Undine ist einerseits eine Stadthistorikerin in Berlin und andererseits der Mythos einer geheimnisvollen Wasserfrau. Als Undines Freund Johannes sie verlässt, scheint ihr Leben zerstört. Sie begegnet dem Industrietaucher Christoph und die beiden verlieben sich. Ist der Undine-Mythos so zu besiegen? Der Film spielt in Berlin, in Christophs Heimat-stadt in NRW und unter Wasser. Die Wendungen der Geschichte sind immer wieder überraschend. Herausragend: Paula Beer als Undine und Franz Rogowski als Christoph. Sie haben schon in Petzolds letztem Film TRANSIT die Hauptrollen gespielt. Die Kameraführung von Hans Fromm und die Montage von Bettina Böhler sind beeindruckend. Der Film von Christian Petzold wurde in diesem Jahr bei der Berlinale uraufgeführt. Sein Kinostart verzögerte sich durch die Corona-Pandemie. Jetzt ist bei good!movies/piffl die DVD des Films erschienen. Zum Bonusmaterial gehört die Pressekonferenz der Berlinale. Das Booklet enthält ein Interview mit Christian Petzold. Mehr zur DVD: php?id=165#zumfilm
Undine ist einerseits eine Stadthistorikerin in Berlin und andererseits der Mythos einer geheimnisvollen Wasserfrau. Als Undines Freund Johannes sie verlässt, scheint ihr Leben zerstört. Sie begegnet dem Industrietaucher Christoph und die beiden verlieben sich. Ist der Undine-Mythos so zu besiegen? Der Film spielt in Berlin, in Christophs Heimat-stadt in NRW und unter Wasser. Die Wendungen der Geschichte sind immer wieder überraschend. Herausragend: Paula Beer als Undine und Franz Rogowski als Christoph. Sie haben schon in Petzolds letztem Film TRANSIT die Hauptrollen gespielt. Die Kameraführung von Hans Fromm und die Montage von Bettina Böhler sind beeindruckend. Der Film von Christian Petzold wurde in diesem Jahr bei der Berlinale uraufgeführt. Sein Kinostart verzögerte sich durch die Corona-Pandemie. Jetzt ist bei good!movies/piffl die DVD des Films erschienen. Zum Bonusmaterial gehört die Pressekonferenz der Berlinale. Das Booklet enthält ein Interview mit Christian Petzold. Mehr zur DVD: php?id=165#zumfilm
27. November 2020
Heinrich und Götz George
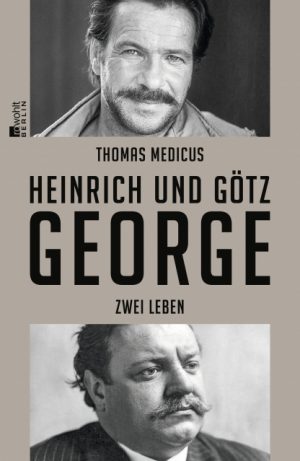 Sie gehörten in ganz unter-schiedlichen Phasen unserer Geschichte zu den populärsten deutschen Schauspielern: Heinrich George (1893-1946) in der Weimarer Republik und der NS-Zeit, Götz George (1938-2016) in der Bundesrepublik von den 60er Jahren bis zu seinem Tod. Die Biografie von Thomas Medicus beschreibt die Zwei Leben mit Genauigkeit und Empathie. Interessant: die Wende von Heinrich George, der sich in der WR links engagiert hatte, nach 1933 zu den Nazis. Er spielte tragende Rollen in HITLERJUNGE QUEX, JUD SÜSS und KOLBERG. Er starb nach einer Operation im sowjetischen Lager Sachsenhausen. Für mich ist der Film SCHLEPPZUG M 17 (1933), bei dem er auch Regie führte, seine größte Leistung, gefolgt von seinem Franz Biberkopf in BERLIN ALEXANDERPLATZ (1931). Natürlich war er auch ein bedeutender Theaterschauspieler. Götz George hatte sein Leben lang eine intensive gedankliche Beziehung zu seinem Vater, den er gegen alle politischen Anfeindungen verteidigt hat. In dem Fernsehfilm GEORGE (2013) spielte er seinen Vater. Die Filmkarriere von Götz begann 1953 als Partner von Romy Schneider in WENN DER WEISSE FLIEDER WIEDER BLÜHT. Zu seinen wichtigsten Kinofilmen gehörten AUS EINEM DEUTSCHEN LEBEN (1977), DIE KATZE (1988), SCHTONK! (1992) und DER TOTMACHER (1995). Ein Fernsehstar wurde er in der Rolle des Kriminalhauptkommissars Horst Schimanski in der TATORT-Reihe (1981-1991), die zu einer eigenen SCHIMANSKI-Reihe (1997-2011) führte. Ich habe das Buch von Thomas Medicus mit großem Interesse gelesen und kann es unbedingt empfehlen. Einen sehr lesenswerten Text über die Doppelbiografie hat Hanns Zischler für die Süddeutsche Zeitung verfasst: zwei-leben-vater-und-sohn-1.5081888. Mehr zum Buch: heinrich-und-goetz-george-9783737100847
Sie gehörten in ganz unter-schiedlichen Phasen unserer Geschichte zu den populärsten deutschen Schauspielern: Heinrich George (1893-1946) in der Weimarer Republik und der NS-Zeit, Götz George (1938-2016) in der Bundesrepublik von den 60er Jahren bis zu seinem Tod. Die Biografie von Thomas Medicus beschreibt die Zwei Leben mit Genauigkeit und Empathie. Interessant: die Wende von Heinrich George, der sich in der WR links engagiert hatte, nach 1933 zu den Nazis. Er spielte tragende Rollen in HITLERJUNGE QUEX, JUD SÜSS und KOLBERG. Er starb nach einer Operation im sowjetischen Lager Sachsenhausen. Für mich ist der Film SCHLEPPZUG M 17 (1933), bei dem er auch Regie führte, seine größte Leistung, gefolgt von seinem Franz Biberkopf in BERLIN ALEXANDERPLATZ (1931). Natürlich war er auch ein bedeutender Theaterschauspieler. Götz George hatte sein Leben lang eine intensive gedankliche Beziehung zu seinem Vater, den er gegen alle politischen Anfeindungen verteidigt hat. In dem Fernsehfilm GEORGE (2013) spielte er seinen Vater. Die Filmkarriere von Götz begann 1953 als Partner von Romy Schneider in WENN DER WEISSE FLIEDER WIEDER BLÜHT. Zu seinen wichtigsten Kinofilmen gehörten AUS EINEM DEUTSCHEN LEBEN (1977), DIE KATZE (1988), SCHTONK! (1992) und DER TOTMACHER (1995). Ein Fernsehstar wurde er in der Rolle des Kriminalhauptkommissars Horst Schimanski in der TATORT-Reihe (1981-1991), die zu einer eigenen SCHIMANSKI-Reihe (1997-2011) führte. Ich habe das Buch von Thomas Medicus mit großem Interesse gelesen und kann es unbedingt empfehlen. Einen sehr lesenswerten Text über die Doppelbiografie hat Hanns Zischler für die Süddeutsche Zeitung verfasst: zwei-leben-vater-und-sohn-1.5081888. Mehr zum Buch: heinrich-und-goetz-george-9783737100847
26. November 2020
Diesseits der Bilder
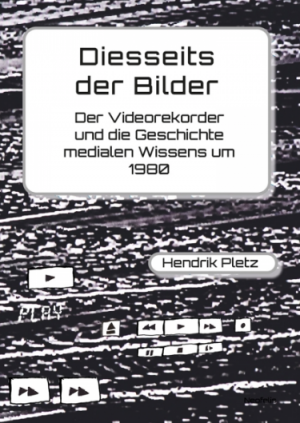 Eine Dissertation, die an der Universität Köln entstanden ist. Hendrik Pletz erforscht darin die Entstehung des Video-rekorders und die Geschichte medialen Wissens um 1980. Eine umfangreiche Einleitung vermittelt die Geschichte des „Video“ und theoretische Vorüberlegungen zu Bildern, Techniken und Subjekten. Drei Teile strukturieren die Arbeit: I. Gesellschaftliche Metamorpho-sen, II. Wissensmaschine VCR, III. Mediale Welten. Die 70er und 80er Jahre werden im gesellschaftlichen Kontext verortet. Dann geht es um Produziertes Wissen, Technisches Wissen und Produktives Wissen. Interessant: die Debatte bei den „Mainzer Tagen der Fernsehkritik“ 1978 über „Wirklichkeit und Fiktion im Fernsehspiel“. Es war die Zeit vor dem Privatfernsehen. ARD, ZDF und Dritte Programme konkurrierten in der BRD um die Zuschauer. Und die Zuschauer wurden durch Videorekorder zu Programmachern, die sich Sendungen unabhängig von der Ausstrahlung ansehen konnten. Aus heutiger Sicht klingt das nach Historie, an die man sich kaum noch erinnert. Aber es ist für Zeitzeugen eine spannende Lektüre. Der Autor hat hervorragend recherchiert. 1.367 Quellenverweise und ein Literaturverzeichnis von 40 Seiten legen davon Zeugnis ab. Mit 17 Texten ist Hartmut Winkler der am häufigsten zitierte Wissenschaftler. Mit Abbildungen in sehr guter Qualität. Mehr zum Buch: diesseits-der-bilder?number=9783958083134
Eine Dissertation, die an der Universität Köln entstanden ist. Hendrik Pletz erforscht darin die Entstehung des Video-rekorders und die Geschichte medialen Wissens um 1980. Eine umfangreiche Einleitung vermittelt die Geschichte des „Video“ und theoretische Vorüberlegungen zu Bildern, Techniken und Subjekten. Drei Teile strukturieren die Arbeit: I. Gesellschaftliche Metamorpho-sen, II. Wissensmaschine VCR, III. Mediale Welten. Die 70er und 80er Jahre werden im gesellschaftlichen Kontext verortet. Dann geht es um Produziertes Wissen, Technisches Wissen und Produktives Wissen. Interessant: die Debatte bei den „Mainzer Tagen der Fernsehkritik“ 1978 über „Wirklichkeit und Fiktion im Fernsehspiel“. Es war die Zeit vor dem Privatfernsehen. ARD, ZDF und Dritte Programme konkurrierten in der BRD um die Zuschauer. Und die Zuschauer wurden durch Videorekorder zu Programmachern, die sich Sendungen unabhängig von der Ausstrahlung ansehen konnten. Aus heutiger Sicht klingt das nach Historie, an die man sich kaum noch erinnert. Aber es ist für Zeitzeugen eine spannende Lektüre. Der Autor hat hervorragend recherchiert. 1.367 Quellenverweise und ein Literaturverzeichnis von 40 Seiten legen davon Zeugnis ab. Mit 17 Texten ist Hartmut Winkler der am häufigsten zitierte Wissenschaftler. Mit Abbildungen in sehr guter Qualität. Mehr zum Buch: diesseits-der-bilder?number=9783958083134
25. November 2020
Verfilmte Autorschaft
 Der Band dokumentiert die Beiträge einer Tagung, die im April 2019 in München statt-gefunden hat. Es geht um „Auftritte von Schriftsteller*in-nen in Dokumentationen und Biopics“. Vom Herausgeberduo Torsten Hoffmann und Doren Wohlleben stammt die informa-tive Einführung. Sigrid Nieberle reflektiert über die „Möglichkei-ten des Verschwindens“ mit diversen Filmbeispielen. Ste-phanie Catani erinnert an die Biopics FRIEDRICH SCHIL-LER (1923) von Curt Goetz und FRIEDRICH SCHILLER. TRIUMPH EINES GENIES (1940) von Herbert Maisch. Gerhard Kaiser richtet seinen Blick auf Schiller in Dominik Grafs DIE GELIEBTEN SCHWESTERN (2014). Agnes Bidman befasst sich mit DIE MANNS. EIN JAHRHUNDERTROMAN (2001) von Heinrich Breloer. Bei Torsten Hoffmann geht es um die Präsenz von Rainer Maria Rilke in PAULA. MEIN LEBEN SOLL EIN FEST SEIN (2016) von Christian Schwochow und in LOU-ANDREAS SALOMÉ (2016) von Cordula Kablitz-Post. Anna-Katharina Gisbertz äußert sich zu VOR DER MORGENRÖTE – STEFAN ZWEIG IN AMERIKA (2016) von Maria Schrader. Stefanie Kreuzer analysiert Steven Soderberghs KAFKA (1991). Jürgen Heizmann beschreibt zwei Brecht-Filme: MACKIE MESSER (2018) von Joachim A. Lang und ABSCHIED – BRECHTS LETZTER SOMMER (2000) von Jan Schütte. Björn Hayer erforscht die Kino-Figur Marguerite Duras in DIESE LIEBE (2001) von Josée Sayan. Thomas Wegmann entdeckt Thomas Bernhard in drei Dokumentarfilmen. Bei Doren Wohlleben geht es um Hilde Domin und Felicitas Hoppe als Filmfiguren. Alexander Honold stellt zwei Peter Handke-Filme gegenüber: DER SCHWERMÜTIGE SPIELER (2002) von Peter Hamm und BIN IM WALD, KANN SEIN, DASS ICH MICH VERSPÄTE (2016) von Corinna Belz. Henrike Serfas informiert über drei Museumsfilme des Literaturarchivs Marbach: über Sibylle Lewitscharoff, Tankred Dorst & Ursula Ehlers und Hanns Zischler. Angela Hildebrand sieht Francisco de Goya in den Spielfilmen von Konrad Wolf und Carlos Saura. Das Protokoll eines Podiumsgesprächs mit Thomas Henke und Marion Kollbach zur Praxis verfilmter Autorenschaft schließt den Band ab. Alle Beiträge auf hohem Niveau. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: 978-3-8376-5063-1
Der Band dokumentiert die Beiträge einer Tagung, die im April 2019 in München statt-gefunden hat. Es geht um „Auftritte von Schriftsteller*in-nen in Dokumentationen und Biopics“. Vom Herausgeberduo Torsten Hoffmann und Doren Wohlleben stammt die informa-tive Einführung. Sigrid Nieberle reflektiert über die „Möglichkei-ten des Verschwindens“ mit diversen Filmbeispielen. Ste-phanie Catani erinnert an die Biopics FRIEDRICH SCHIL-LER (1923) von Curt Goetz und FRIEDRICH SCHILLER. TRIUMPH EINES GENIES (1940) von Herbert Maisch. Gerhard Kaiser richtet seinen Blick auf Schiller in Dominik Grafs DIE GELIEBTEN SCHWESTERN (2014). Agnes Bidman befasst sich mit DIE MANNS. EIN JAHRHUNDERTROMAN (2001) von Heinrich Breloer. Bei Torsten Hoffmann geht es um die Präsenz von Rainer Maria Rilke in PAULA. MEIN LEBEN SOLL EIN FEST SEIN (2016) von Christian Schwochow und in LOU-ANDREAS SALOMÉ (2016) von Cordula Kablitz-Post. Anna-Katharina Gisbertz äußert sich zu VOR DER MORGENRÖTE – STEFAN ZWEIG IN AMERIKA (2016) von Maria Schrader. Stefanie Kreuzer analysiert Steven Soderberghs KAFKA (1991). Jürgen Heizmann beschreibt zwei Brecht-Filme: MACKIE MESSER (2018) von Joachim A. Lang und ABSCHIED – BRECHTS LETZTER SOMMER (2000) von Jan Schütte. Björn Hayer erforscht die Kino-Figur Marguerite Duras in DIESE LIEBE (2001) von Josée Sayan. Thomas Wegmann entdeckt Thomas Bernhard in drei Dokumentarfilmen. Bei Doren Wohlleben geht es um Hilde Domin und Felicitas Hoppe als Filmfiguren. Alexander Honold stellt zwei Peter Handke-Filme gegenüber: DER SCHWERMÜTIGE SPIELER (2002) von Peter Hamm und BIN IM WALD, KANN SEIN, DASS ICH MICH VERSPÄTE (2016) von Corinna Belz. Henrike Serfas informiert über drei Museumsfilme des Literaturarchivs Marbach: über Sibylle Lewitscharoff, Tankred Dorst & Ursula Ehlers und Hanns Zischler. Angela Hildebrand sieht Francisco de Goya in den Spielfilmen von Konrad Wolf und Carlos Saura. Das Protokoll eines Podiumsgesprächs mit Thomas Henke und Marion Kollbach zur Praxis verfilmter Autorenschaft schließt den Band ab. Alle Beiträge auf hohem Niveau. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: 978-3-8376-5063-1
24. November 2020
Um die Welt mit den Thaws
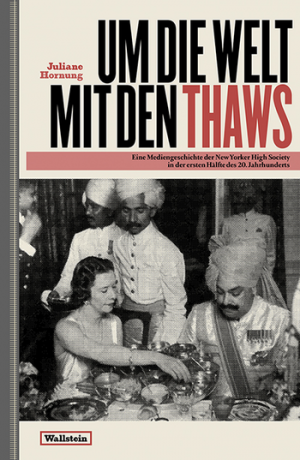 Eine Dissertation, die an der Ludwig-Maximilian-Univer-sität München entstanden ist. Juliane Hornung erzählt darin eine Mediengeschichte der New Yorker High Society aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Ehepaar Margaret und Lawrence Thaw sind die Protagonisten der Untersuchung. Ihr Nachlass – Filme, Fotos, Presseartikel, Tagebücher – enthält alle dafür notwen-digen Materialien. Aus-gangspunkt ist ihre Hochzeitsreise 1924 nach Europa: England, Frankreich, Italien. Lawrence filmte, Margaret agierte vor der Kamera. Die Selbstinszenierung vor wechselndem Hintergrund war zunächst ein Kernelement der Filmarbeit. Die Ergebnisse wurden im privaten Kreis vorgeführt. Es folgten Filme über Reisen nach Palm Beach und in die Karibik. Dann geschah langsam eine Professionalisierung. Mitte der 1930er Jahre entstanden zwei Afrika-Filme, 1939/40 zwei Filme über Indien, die in den USA auch in den Kinos zu sehen waren. Juliane Hornung beschreibt sehr detailliert, die mediale Selbstinszenierung des Ehepaares vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung in den USA. Mit zahlreichen Abbildungen und Filmausschnitten. Sehr lesenswert. Mehr zum Buch: um-die-welt-mit-den-thaws.html
Eine Dissertation, die an der Ludwig-Maximilian-Univer-sität München entstanden ist. Juliane Hornung erzählt darin eine Mediengeschichte der New Yorker High Society aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Ehepaar Margaret und Lawrence Thaw sind die Protagonisten der Untersuchung. Ihr Nachlass – Filme, Fotos, Presseartikel, Tagebücher – enthält alle dafür notwen-digen Materialien. Aus-gangspunkt ist ihre Hochzeitsreise 1924 nach Europa: England, Frankreich, Italien. Lawrence filmte, Margaret agierte vor der Kamera. Die Selbstinszenierung vor wechselndem Hintergrund war zunächst ein Kernelement der Filmarbeit. Die Ergebnisse wurden im privaten Kreis vorgeführt. Es folgten Filme über Reisen nach Palm Beach und in die Karibik. Dann geschah langsam eine Professionalisierung. Mitte der 1930er Jahre entstanden zwei Afrika-Filme, 1939/40 zwei Filme über Indien, die in den USA auch in den Kinos zu sehen waren. Juliane Hornung beschreibt sehr detailliert, die mediale Selbstinszenierung des Ehepaares vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung in den USA. Mit zahlreichen Abbildungen und Filmausschnitten. Sehr lesenswert. Mehr zum Buch: um-die-welt-mit-den-thaws.html
22. November 2020
KUHLE WAMPE (1932)
 Berlin 1931. Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Depression. Im Mittelpunkt der drei episodi-schen Stationen steht ein junges Arbeiterpaar: Anni und Fritz. Annis Bruder stürzt sich zu Beginn des Films aus Ver-zweiflung aus dem Fenster, weil er keine Arbeit findet. Seiner Familie wird die Wohnung gekündigt, sie zieht auf den Zeltplatz Kuhle Wampe am Rande von Berlin. Anni erwartet ein Kind von Fritz, aber es gibt kurz nach der Verlobung Streit zwischen ihnen, sie verlässt ihn und zieht zu einer Freundin. Nachdem sie sich auf einem Arbeitersportfest wiedergesehen haben, versöhnen sie sich. Der Film von Slatan Dudow nach einem Drehbuch von Bert Brecht und Ernst Ottwalt ist ein Klassiker des proletarischen Films und auch nach 90 Jahren unbedingt (wieder)sehenswert. In den Haupt-rollen: Hertha Thiele als Anni und Ernst Busch als Fritz. Die Musik stammt von Hanns Eisler. Hinter der Kamera stand Günther Krampf. Die Bildgestaltung hat dokumentarische Qualitäten. Bei Atlas Film ist jetzt ein Mediabook des Films mit DVD und Blu-ray der restaurierten Fassung erschienen. Mit einem sehr informativen Booklet von Martin Koerber und Charlotte Schmid. Mehr zur DVD: kuhle-wampe.html
Berlin 1931. Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Depression. Im Mittelpunkt der drei episodi-schen Stationen steht ein junges Arbeiterpaar: Anni und Fritz. Annis Bruder stürzt sich zu Beginn des Films aus Ver-zweiflung aus dem Fenster, weil er keine Arbeit findet. Seiner Familie wird die Wohnung gekündigt, sie zieht auf den Zeltplatz Kuhle Wampe am Rande von Berlin. Anni erwartet ein Kind von Fritz, aber es gibt kurz nach der Verlobung Streit zwischen ihnen, sie verlässt ihn und zieht zu einer Freundin. Nachdem sie sich auf einem Arbeitersportfest wiedergesehen haben, versöhnen sie sich. Der Film von Slatan Dudow nach einem Drehbuch von Bert Brecht und Ernst Ottwalt ist ein Klassiker des proletarischen Films und auch nach 90 Jahren unbedingt (wieder)sehenswert. In den Haupt-rollen: Hertha Thiele als Anni und Ernst Busch als Fritz. Die Musik stammt von Hanns Eisler. Hinter der Kamera stand Günther Krampf. Die Bildgestaltung hat dokumentarische Qualitäten. Bei Atlas Film ist jetzt ein Mediabook des Films mit DVD und Blu-ray der restaurierten Fassung erschienen. Mit einem sehr informativen Booklet von Martin Koerber und Charlotte Schmid. Mehr zur DVD: kuhle-wampe.html
20. November 2020
Creative Leadership
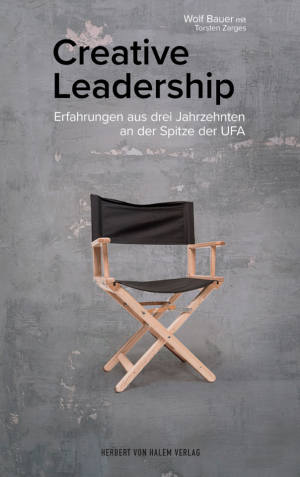 27 Jahre lang war Wolf Bauer (*1950) als CEO der UFA ver-antwortlich für den enormen Wachstum und die Veränderun-gen der Firma, die heute das größte deutsche Produktions-unternehmen der Medien-branche ist. 2017 hat er sich aus der Leitung verabschiedet. Seine Erfahrungen vermittelt er in dem Buch „Creative Leader-ship“. Die 13 Kapitel haben jeweils ein spezifisches Substan-tiv als Überschrift: Freiheit – Verantwortung – Forscher-drang – Ausdauer – Souverä-nität – Gründergeist – Innova-tion – Führungsstärke – Agilität – Demut – Scheitern – Brückenschlag – Sehnsucht; es folgt immer eine inhaltlich Frage, zum Beispiel bei „Gründergeist“: Wie findet man den richtigen Rahmen für Expansion und Diversifikation?, bei „Scheitern“: Warum ist ein blaues Auge dann und wann gar nicht schlimm?, bei „Brückenschlag“: Wie lassen sich Kultur- und Wirtschaftsfaktoren unter einen Hut bringen? Bauer hat für das öffentlich-rechtliche und das private Fernsehen produziert. Zu seinen erfolgreichsten Kreationen gehören die Serien GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN (seit 1992 bei RTL), UNTER UNS (seit 1994 bei RTL), VERBOTENE LIEBE (1995-2015 in der ARD) und die Casting-Show DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR (seit 2002 bei RTL). Seine besondere Zuneigung gilt dem Kinofilm. In den 1980er Jahren war er bei der UFA für die Didi-Filme mit Dieter Hallervorden verantwortlich. 2013 galt die 26-Millionen-Euro-Produktion DER MEDICUS als Großprojekt. Bauers internationale Verbindungen haben für Inspirationen und Erweiterungen gesorgt. Auf 160 Seiten erzählt er von seinen beruflichen Erfahrungen, beginnend mit Seminaren an der FU bei Harry Pross und der Zusammenarbeit mit Hanns-Dieter Schwarze beim ZDF, endend mit der Verabschiedung aus seinem Erfolgsunternehmen. Das ist informativ, auch unterhaltsam und öffnet den Blick hinter die Kulissen der Medienbranche. Sehr lesenswert. Mit einem 16-seitigen Bildteil. Mehr zum Buch: creative-leadership/
27 Jahre lang war Wolf Bauer (*1950) als CEO der UFA ver-antwortlich für den enormen Wachstum und die Veränderun-gen der Firma, die heute das größte deutsche Produktions-unternehmen der Medien-branche ist. 2017 hat er sich aus der Leitung verabschiedet. Seine Erfahrungen vermittelt er in dem Buch „Creative Leader-ship“. Die 13 Kapitel haben jeweils ein spezifisches Substan-tiv als Überschrift: Freiheit – Verantwortung – Forscher-drang – Ausdauer – Souverä-nität – Gründergeist – Innova-tion – Führungsstärke – Agilität – Demut – Scheitern – Brückenschlag – Sehnsucht; es folgt immer eine inhaltlich Frage, zum Beispiel bei „Gründergeist“: Wie findet man den richtigen Rahmen für Expansion und Diversifikation?, bei „Scheitern“: Warum ist ein blaues Auge dann und wann gar nicht schlimm?, bei „Brückenschlag“: Wie lassen sich Kultur- und Wirtschaftsfaktoren unter einen Hut bringen? Bauer hat für das öffentlich-rechtliche und das private Fernsehen produziert. Zu seinen erfolgreichsten Kreationen gehören die Serien GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN (seit 1992 bei RTL), UNTER UNS (seit 1994 bei RTL), VERBOTENE LIEBE (1995-2015 in der ARD) und die Casting-Show DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR (seit 2002 bei RTL). Seine besondere Zuneigung gilt dem Kinofilm. In den 1980er Jahren war er bei der UFA für die Didi-Filme mit Dieter Hallervorden verantwortlich. 2013 galt die 26-Millionen-Euro-Produktion DER MEDICUS als Großprojekt. Bauers internationale Verbindungen haben für Inspirationen und Erweiterungen gesorgt. Auf 160 Seiten erzählt er von seinen beruflichen Erfahrungen, beginnend mit Seminaren an der FU bei Harry Pross und der Zusammenarbeit mit Hanns-Dieter Schwarze beim ZDF, endend mit der Verabschiedung aus seinem Erfolgsunternehmen. Das ist informativ, auch unterhaltsam und öffnet den Blick hinter die Kulissen der Medienbranche. Sehr lesenswert. Mit einem 16-seitigen Bildteil. Mehr zum Buch: creative-leadership/
19. November 2020
Film und Text
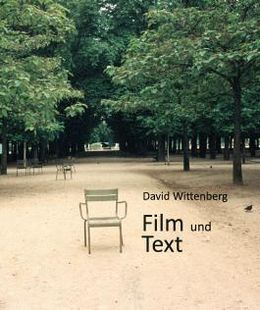 David Wittenberg (*1940) hat zwischen 1967 und 2010 insgesamt 66 Dokumentarfilme realisiert. In den ersten 16 Jahren arbeitete er dabei mit Edith Schmidt zusammen. Viele Filme sind nur 15 Minuten lang, einige dauern 90 Minuten und mehr. In der ersten Phase dominierten die Beobachtungen. Oft ging es dabei um Arbeitskonflikte. Bekannt wurde damals vor allem DER KAMPF DER LIP-ARBEITER (1973-75): über den wochenlangen Streik in der Uhren- und Werkzeugmaschinenfabrik in Besançon. Seit den 80er Jahren entstanden vor allem essayistische Porträts. Höhepunkte: DIE ZUKUNFT HAT EIN ALTES HERZ (1992) über den Philosophen Walter Benjamin, DIE WÜRDE EINES JEDEN MENSCHEN (1995) über den Staatsanwalt Fritz Bauer, DAS WEITE SUCHEN (2005) über den Ausstellungsmacher Harald Szeemann. Das Buch „Film und Text“, herausgegeben von Irma Wittenberg, dokumentiert in zahlreichen Texten und Bildern das Lebenswerk des Dokumentaristen. Zu lesen sind Filmentwürfe, Erinnerungen, Protokolle von Arbeitskonflikten, Essays. Zu sehen sind Fotos und Zeichnungen. Mit einem Vorwort von Detlev Claussen und einem Nachwort von Dietrich Leder. Das Buch ist bei Sa.Ga – Verlag für die Gesellschaft in Tblissi/Georgien erschienen und wird vom Schüren Verlag vertrieben. Unbedingt zu empfehlen. Mehr zum Buch: 663-film-und-text.html
David Wittenberg (*1940) hat zwischen 1967 und 2010 insgesamt 66 Dokumentarfilme realisiert. In den ersten 16 Jahren arbeitete er dabei mit Edith Schmidt zusammen. Viele Filme sind nur 15 Minuten lang, einige dauern 90 Minuten und mehr. In der ersten Phase dominierten die Beobachtungen. Oft ging es dabei um Arbeitskonflikte. Bekannt wurde damals vor allem DER KAMPF DER LIP-ARBEITER (1973-75): über den wochenlangen Streik in der Uhren- und Werkzeugmaschinenfabrik in Besançon. Seit den 80er Jahren entstanden vor allem essayistische Porträts. Höhepunkte: DIE ZUKUNFT HAT EIN ALTES HERZ (1992) über den Philosophen Walter Benjamin, DIE WÜRDE EINES JEDEN MENSCHEN (1995) über den Staatsanwalt Fritz Bauer, DAS WEITE SUCHEN (2005) über den Ausstellungsmacher Harald Szeemann. Das Buch „Film und Text“, herausgegeben von Irma Wittenberg, dokumentiert in zahlreichen Texten und Bildern das Lebenswerk des Dokumentaristen. Zu lesen sind Filmentwürfe, Erinnerungen, Protokolle von Arbeitskonflikten, Essays. Zu sehen sind Fotos und Zeichnungen. Mit einem Vorwort von Detlev Claussen und einem Nachwort von Dietrich Leder. Das Buch ist bei Sa.Ga – Verlag für die Gesellschaft in Tblissi/Georgien erschienen und wird vom Schüren Verlag vertrieben. Unbedingt zu empfehlen. Mehr zum Buch: 663-film-und-text.html
18. November 2020
Ort und Zeit
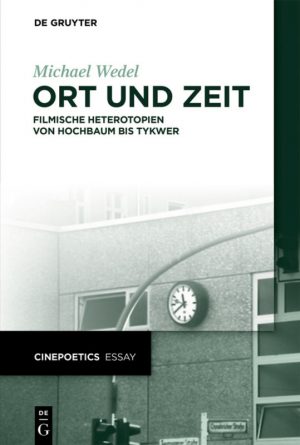 In fünf beeindruckenden Film-analysen erforscht Michael Wedel filmische Heterotopien. Dies sind die ausgewählten Filme: das Frauendrama EIN MÄDCHEN GEHT AN LAND (1938) von Werner Hochbaum mit Elisabeth Flickenschildt, die DEFA-Komödie EIN LORD AM ALEXANDERPLATZ (1967) von Günter Reisch mit Erwin Geschonneck, der 16 Minuten lange POLIZEIFILM (1968) von Wim Wenders, die Murnau-Hommage DIE SONNEN-GÖTTIN (1992) von Rudolf Thome und der experimentelle Thriller LOLA RENNT (1998) von Tom Tykwer mit Franka Potente und Moritz Bleibtreu. Die Unterschiedlichkeit der Filme öffnet ein weites Feld für die analytischen Erkundungen. Natürlich spielt auch der zeithistorische Hintergrund (NS-Zeit, DDR, das Jahr 68, Internationalität, Berlin nach der Wende) eine wichtige Rolle. Es ist spannend zu lesen, wie der Autor die Schauplätze (Hamburg, Ost-Berlin, München, New York-Berlin-Athen-Santorini, Berlin) erschließt und filmhistorische Zusammenhänge herstellt. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Coverfoto: Screenshot aus LOLA RENNT. Band 1 der neuen Buchreihe „Cinepoetics Essay“, herausgegeben von Hermann Kappelhoff und Michael Wedel im Verlag De Gruyter. Mehr zum Buch: https://www.degruyter.com/view/title/535017
In fünf beeindruckenden Film-analysen erforscht Michael Wedel filmische Heterotopien. Dies sind die ausgewählten Filme: das Frauendrama EIN MÄDCHEN GEHT AN LAND (1938) von Werner Hochbaum mit Elisabeth Flickenschildt, die DEFA-Komödie EIN LORD AM ALEXANDERPLATZ (1967) von Günter Reisch mit Erwin Geschonneck, der 16 Minuten lange POLIZEIFILM (1968) von Wim Wenders, die Murnau-Hommage DIE SONNEN-GÖTTIN (1992) von Rudolf Thome und der experimentelle Thriller LOLA RENNT (1998) von Tom Tykwer mit Franka Potente und Moritz Bleibtreu. Die Unterschiedlichkeit der Filme öffnet ein weites Feld für die analytischen Erkundungen. Natürlich spielt auch der zeithistorische Hintergrund (NS-Zeit, DDR, das Jahr 68, Internationalität, Berlin nach der Wende) eine wichtige Rolle. Es ist spannend zu lesen, wie der Autor die Schauplätze (Hamburg, Ost-Berlin, München, New York-Berlin-Athen-Santorini, Berlin) erschließt und filmhistorische Zusammenhänge herstellt. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Coverfoto: Screenshot aus LOLA RENNT. Band 1 der neuen Buchreihe „Cinepoetics Essay“, herausgegeben von Hermann Kappelhoff und Michael Wedel im Verlag De Gruyter. Mehr zum Buch: https://www.degruyter.com/view/title/535017